Lotte Schüßler: Theaterausstellungen. Spielräume der Geisteswissenschaften um 1900.
Göttingen: Wallstein 2022. ISBN: 978-3-8353-5192-9. 291 Seiten, 35,00 €.
DOI:
https://doi.org/10.25365/rezens-2024-1-03Abstract
Mit dem Frühling beginnt heuer die Tanz-, Theater- und Musikfestivalsaison. Die Festivals bieten einerseits dem größtenteils lokalen Publikum in einer kurzen Zeitspanne einen intensiven Einblick in das aktuelle Schaffen internationaler Künstler*innen. Sie sind andererseits Plattformen, auf denen sich die unterschiedlichen Berufsgruppen miteinander austauschen und dies zurück in ihre Praxis tragen. Anders als vor etwa hundert Jahren finden hingegen Großausstellungen mit integrierten Jahrmärken, die einen spezifischen Fokus auf Theater haben, heute nicht mehr statt.
Diesen sogenannten Theaterausstellungen widmet sich Lotte Schüßler in ihrer 2022 im Wallstein Verlag erschienen Studie Theaterausstellungen. Spielräume der Geisteswissenschaften um 1900. Darin untersucht die Theaterwissenschaftlerin, wie und in welchen interdisziplinären Zusammenhängen das zeitgenössische und historische lokale, deutschsprachige und internationale Theaterschaffen ausgestellt wurde und diskutiert deren grundlegende Rolle als Diskursplattformen für die Professionalisierung und Institutionalisierung der Theaterwissenschaft. Schüßler geht in ihrer Monografie von der These aus, dass Theaterausstellungen "zentrale Orte der Produktion und Rezeption geisteswissenschaftlichen Wissens waren – Spielräume, in denen die Geisteswissenschaften mit unterschiedlichen Medien experimentierten und sich hierbei konstituierten" (S. 10f).
Im ausgehendem 19. und beginnenden 20. Jahrhundert befand sich die Ausstellungskultur in ihrer Hochphase; auf Welt-, National- oder Kunst- und Gewerbeausstellungen kamen Wissensvermittlung und -formierung, (nationaler) Wettbewerb und Vergnügungskultur zusammen. Anders als bei Weltausstellungen, zu denen zahlreiche kritische Publikationen vorliegen, ist die hier besprochene Publikation bisher die einzige wissenschaftliche Auseinandersetzung, die sich spezifisch mit Theaterausstellungen im deutschsprachigen Raum und im Kontext der Großausstellungen befasst. Drei der Theaterausstellungen stehen im Mittelpunkt: Die Internationale Ausstellung für Musik- und Theaterwesen in Wien (1892), die Deutsche Theaterausstellung in Berlin (1910) und die Deutsche Theater-Ausstellung Magdeburg (1927), nach deren Ende es Theaterausstellungen in dieser Form nicht mehr gab. Es sind Ausstellungen, die in unterschiedlicher Weise miteinander in Beziehung stehen und die für die Geschichte der Geisteswissenschaften im Allgemeinen und der Theaterwissenschaft im Besonderen maßgebend sind.
Die Autorin widmet sich in jeweils einem Kapitel einer Ausstellung. Sie beleuchtet dabei geisteswissenschaftliche Medien und Praktiken, die sich durch ihre visuellen, plastischen und auditiven Eigenschaften auszeichneten und sich dadurch von sprachbasierten akademischen Praktiken unterschieden. Trotz der sehr unterschiedlichen Quellenlagen zu den drei Ausstellungen, untersucht Schüßler mittels minutiösen Archivrecherchen, breit ausgelegter Referenzliteratur und vergleichender Diskussionen, wie diese Ausstellungen Medien des Wissens über Theater (und andere Künste) hervorbrachten. In Bezug auf die Entstehung der Geisteswissenschaften um die Wende zum 20. Jahrhundert schlussfolgert sie dementsprechend: "Die Geisteswissenschaften […] bestritten ihre Diskurse nicht nur mit Büchern und Vorlesungen. Sie formierten sich ebenso in architektonischen Räumen, mit materiellen Objekten, wissenschaftlichen wie populären und pädagogischen Medien und Praktiken, welche die Großausstellungskultur erst ermöglichte" (S. 244).
In ihren differenzierten Analysen geht die Autorin einerseits von der grundlegenden Interdisziplinarität ihres Gegenstands aus und setzt andererseits bestimmte Schwerpunkte, die die Konstituierung der deutschsprachigen Theaterwissenschaft, außerhalb eines institutionellen universitären Rahmens, näher beleuchten.
Im Kapitel zur Musik- und Theaterausstellung in Wien wird die Ausstellung beider Geisteswissenschaften während beziehungsweise vor ihrer universitären Etablierung verglichen. Die Untersuchung der jeweils eigenen kuratorischen Konzepte und zweier entsprechender Publikationsprojekte macht deutlich, dass sich die Disziplinen der Musik- und Theaterwissenschaft sowohl als sammelnde und ordnende Wissenschaften formierten, als auch äußerst unterschiedliche Bedürfnisse an die Wissensvermittlung aufweisen.
Für das Kapitel zur Deutschen Theaterausstellung in Berlin legt die Autorin den Fokus auf die produktiven Beziehungen von Theater- und Literaturwissenschaft, indem sie auf medien- und wissenstheoretische Diskurse und wissenschaftspolitische Debatten eingeht. Anhand der virulenten öffentlichen Diskussion um papierene Ausstellungsexponate und theaterhistorische Quellen, wird – entgegen dem Abgrenzungsnarrativ der Theaterwissenschaft gegenüber der Literaturwissenschaft – deutlich, dass sich beide Disziplinen dezidiert geisteswissenschaftliche Argumente für die Forderung nach eigenen Museen und Archiven teilten. Ebenso selten für die deutschsprachige Fachgeschichtsschreibung der Theaterwissenschaft ist die Perspektive auf das starke akademische Selbstverständnis der Theaterwissenschaft, das sich auch in Reaktion auf die Ausstellung in Berlin, rund zehn Jahre vor der ersten Institutsgründung, öffentlich offenbarte.
Im dritten Kapitel zur Theater-Ausstellung in Magdeburg wird deutlich, dass sich die Theaterwissenschaft – inzwischen als universitäre Disziplin – mit einem gefestigten Selbstverständnis einer breiten Öffentlichkeit präsentiert, indem unter anderem in den Ausstellungsräumen Kongresse durchgeführt und Diskurse fortgeführt wurden. Den Schwerpunkt auf architektonische und diskursive Räume legend, zeigt Schüßler ferner auf, wie durch die Sonderausstellungen zu Film, Rundfunk und Lautforschung/Grammophon sich die Theaterwissenschaft neuen Medien gegenüber interessiert positioniert und innerhalb einer interdisziplinären Konstellation perspektiviert.
Die drei Theaterausstellungen sind, so wird in dieser Studie deutlich gemacht, Spielräume, in denen geisteswissenschaftliche Diskurse und Disziplinen durch multiple Ausstellungsmaterialien verhandelt und mitgestaltet werden. Die Medien und Praktiken sind wissenschaftlich, populär und pädagogisch zugleich, wodurch sich auch die Theaterwissenschaft in ihrer Gründungsphase profiliert und professionalisiert.
Als roter Faden zieht sich durch die Studie dementsprechend auch die Analyse und Diskussion der unterschiedlichen Auffassungen des Streitbegriffs der "Anschauung". Schüßler zeichnet nach, wie zentral der Begriff für die Bestrebungen um die möglichst sinnliche und zugängliche Vermittlung von Wissen über Theater war, die mittels visueller und plastischer Medien in den jeweiligen Ausstellungen verhandelt wurde. Demgegenüber steht der geisteswissenschaftliche Anschauungsbegriff, den Wissenschaftler*innen in dezidierter Abgrenzung zur sinnlichen Wissensvermittlung hervorbrachten. Im Gegensatz zu visuell-plastischen und populären Vermittlungsformen, beschreibt der geisteswissenschaftliche Anschauungsbegriff einen innerlichen geistigen Prozess, der insbesondere über sprachbasierte (schriftliche) Medien geformt und vermittelt werden soll.
Dieser rote Faden verleiht der Studie eine Verbindung zu noch beziehungsweise wieder aktuellen und virulenten Diskussionen um die Wissenschaftsvermittlung. Damit einher würde auch die aktuelle Positionierung universitärer geisteswissenschaftlicher Fächer gegenüber didaktisch sinnlichen Formen der Verhandlung von Wissen und ihrer Zugänglichkeit für ein breites Publikum gehen. In der Publikation fehlt jedoch diese Brücke in die Gegenwart, was weniger als Kritik, als vielmehr als Einladung an die zukünftigen Leser*innen verstanden werden soll. Denn wie lohnend der Blick auf unterschiedliche interdisziplinäre Konstellationen, populäre Formate und angewandte Forschungsvorhaben für die Geschichtsschreibung der/einzelner Geisteswissenschaft/en ist, führt Lotte Schüßler in dieser Monografie auf gewinnende, wissenschaftlich versierte, gut strukturierte und nicht zuletzt äußerst anschauliche Weise vor.
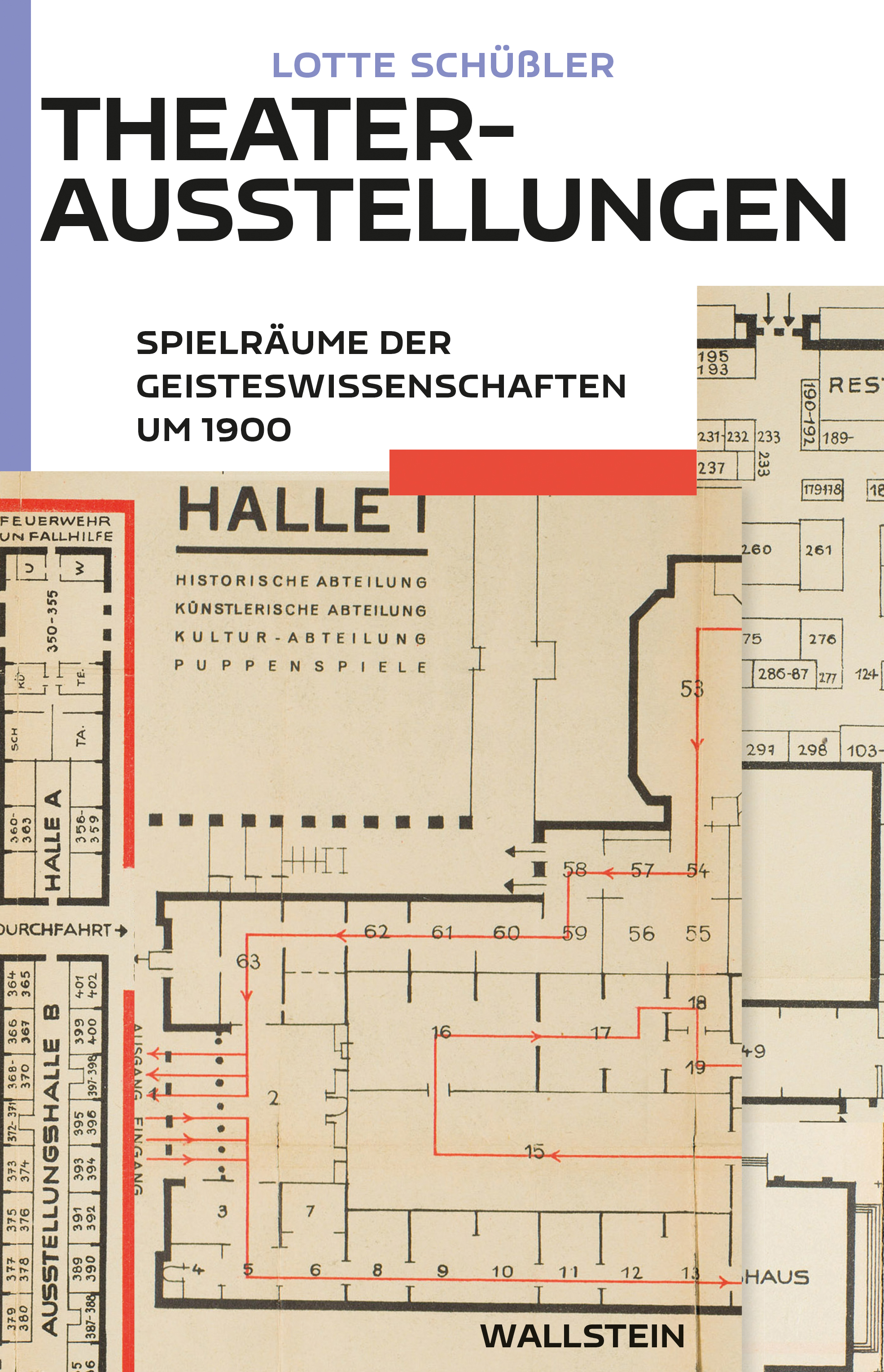
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2024 Johanna Hilari

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



