Francesco Casetti: Screening Fears: On Protective Media.
New York: Zone Books 2023. ISBN: 9781942130871. 272 Seiten, 29,95 €.
DOI:
https://doi.org/10.25365/rezens-2025-1-08Abstract
Bereits 2008, zur Zeit des von Apple ausgelösten Smartphone-Booms, entwickelte der italienisch-US-amerikanische Filmtheoretiker Francesco Casetti die Idee der "safe bubble" (Casetti 2008, S. 11) – einer imaginären Blase, die Rezipierende mobiler Screens zum Zwecke einer möglichst ungestörten Rezeptionserfahrung um sich herum konstruieren. 2011 sprach er zugespitzt von einer "existential bubble", in die sich Rezipierende regelrecht 'vergraben', und führte hierzu eines seiner Lieblingsbeispiele an: "I am thinking of the train passengers who watch films on a portable device, isolating themselves from their immediate context by putting on headphones and ignoring all that is going on around them" (Casetti 2011, S. 10). Die Blase stellte Casetti als fragil dar, da sie durch die kleinste Störung – etwa die Fahrkartenkontrolle oder den nächsten Halt – zerbrochen werden könnte.
2015 fand der Begriff der existenziellen Blase Eingang in Casettis für die Filmtheorie wegweisendes Buch The Lumière Galaxy. Seven Key Words for the Cinema to Come, in dem das Kino mittels des Konzepts der Relokalisierung redefiniert wird, um es in die veränderten Realitäten ubiquitärer Screens oder 'explodierender' Streaming- und Social-Media-Angebote bei zugleich schwindendem Kinobesuch 'hinüberzuretten'. Casetti beschrieb das Dispositiv des relokalisierten Kinos als eine Assemblage aus verschiedenen audiovisuellen Praktiken (z. B. mithilfe von Kopfhörern eine existenzielle Blase aufbauen), dem fortwährend reterritorialisierten, d. h. nicht länger ortsgebundenem Rezeptionsraum (etwa im Zug), einer Reihe von symbolischen Bedürfnissen (z. B. träumen, Geschichten folgen, die Welt interpretieren usw.) sowie natürlich dem Film selbst (Casetti 2015, S. 81–83).
Mit Screening Fears. On Protective Media legt Casetti 15 Jahre nach der ursprünglichen Idee der "safe bubble" eine kleine Mediengeschichte protektiver, d. h. vor schädigenden Einwirkungen der Außenwelt schützender Medien vor. Er führt zwar höchst unterschiedliche Beispiele an – eine Militärperson, die im Zweiten Weltkrieg, von Landkarten und technischen Vorrichtungen umgeben, auf einem Radarbildschirm ein potenzielles Ziel verfolgt; eine Familie, die sich in den 1950er Jahren um einen Fernseher schart, um gemeinsam Zeit zu verbringen; eine Polizeikraft, die in den 1990er Jahren in einem Raum voller Überwachungsmonitore den Aufmerksamkeit erfordernden Stadtteil zu identifizieren versucht (S. 19) –, konzentriert seine Untersuchung jedoch auf die drei Hauptbeispiele Phantasmagorie, eine Ende des 18. Jahrhunderts kurzzeitig verbreitete, das Publikum in Schrecken versetzende optische Täuschung zur Darstellung von Geistern; das (klassische) Kino, das viele aus dem 20. Jahrhundert kennen; und schließlich die heutigen Blasen, die Casetti nunmehr verallgemeinert als elektronisch, elektronisch-Screen-basiert, digital, digital-vernetzt oder virtuell bezeichnet. Seine drei Dispositive umfassende Geschichtsschreibung – Phantasmagorie, Kino, Screen-basierte Blasen – erinnert konzeptuell an Peter Sloterdijks Sphären-Trilogie (Blasen 1998, Globen 1999, Schäume 2004) und hat zum Ziel, den von Casetti formulierten Projektions/Protektions-Komplex, einen, wie er meint, der Schlüsselmechanismen in der Geschichte moderner Medien (S. 16), anhand der drei für ihn repräsentativsten Erscheinungsformen zu beleuchten. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, des Klimawandels (S. 35) und des für den Menschen feindlichen Anthropozäns (wie Casetti es nennt, S. 38), ist die Screen-basierte Konzeptualisierung bzw. die topologische Historiografie protektiver Medien ein offenkundig relevantes Unterfangen.
Der Titel Screening Fears ist – als stamme er von gewieften Songwriter*innen – mehrdeutig: er kann den Prozess des Zeigens bzw. Auslösens von Furcht meinen, oder aber den Schutzschild vor derselben. Entsprechend elaboriert ist die Dramaturgie des Buches. Die Ausführungen zu Phantasmagorie (Kapitel 2), Kino (Kapitel 3) und digital-vernetzten Blasen (Kapitel 4) sind zweifach eingebettet: in eine Genealogie von Screens (Kapitel 1), die dem topologischen Paradigma folgend auf das Verschmelzen von "screen" und "space" und damit auf "screenscape" aus ist (S. 27), und Linderungsstrategien ("strategies of mitigation", Kapitel 5), zu welchen Casetti disziplinarische und immune Praktiken zählt. Damit ist gemeint, dass allen drei Dispositiven Ordnungen zugrunde liegen, die von 'guten' Rezipierenden befolgt werden (S. 153), und dass die von Screens gezeigte bzw. ausgelöste Furcht eine abgeschwächte, immunisierende Version einer echten Gefahr in der Außenwelt darstellt (S. 156). Die zweite Einbettung leisten die Einleitung mit ihrem Hinweis auf die im Allgemeinen protektive Natur der (Kino-)Leinwand (S. 13) und der Epilog mit dem angesichts des weltweiten Rechtsrucks wesentlichen Verweis auf Hyperprotektion ("overprotection"): "Human societies that increase their defenses beyond what is necessary create the conditions for their own collapse" (S. 170).
In den Hauptkapiteln gewährt Casetti eine Reihe mitunter unerwarteter Einsichten zum Projektions/Protektions-Komplex. Die Phantasmagorie (Kapitel 2) ermöglichte den Rezipierenden die Immersion in, sowie die Erkundung von, drei liminalen Welten: des in den Geister-Projektionen zu erlebenden Totenreichs; unserer Welt, deren physische Beschaffenheit z. B. in einem eigens dafür konzipierten Vorraum sowie während der Vorstellungen durch atmosphärische Effekte wie Donner und Blitz abgebildet wurde; sowie der eigenen inneren Welt (S. 48). Letzteres ist insofern bezeichnend, als "spectators' emotional expressions and outbursts were part of the show" (S. 62) und die Phantasmagorie – psychologisch betrachtet – ein Mittel der Selbstfindung. Das Kino (Kapitel 3), von Casetti bereits im Kapitelnamen als Raum für Komfort gepriesen, wartete mit Klimaanlage und Heizung auf, also mit "manufactured weather" ("Movie theaters were advertised as safer than open air", S. 87), bot eine (etwa im Hinblick auf Feuerschutz) sichere und durch Platzanweisende geordnete soziale Zusammenkunft an und stellte eine auf die menschliche Wahrnehmung optimierte Seherfahrung bereit. Die Screen-basierten Blasen (Kapitel 4) schließlich decken sich weitgehend mit unserem peripersonalen Raum, den wir mit unseren Körpergliedern erreichen können (S. 122f). Mit ihren immateriellen Grenzen machen die Blasen "distant objects close and immediate surroundings distant" (S. 127). Spannend ist, dass Casetti dieser "closeness within a distance" den Effekt der "distance within a closeness" gegenüberstellt, den Schutzmasken seit Ausbruch der Corona-Pandemie erzielen (S. 118). Casettis Überlegungen zur Großaufnahme im Vollbild oder in den Kacheln von Online-Meetings sind ebenfalls erhellend: "When in full screen, these vignettes reiterate the idea of intimacy […]. When in a grid, they add to this intimacy the effects of the split screen – a split screen in which we can at once check the others and monitor ourselves" (S. 128).
Ein besonderer dramaturgischer Kniff sind die vier Intermezzi, die Casetti zwischen den Kapiteln 1 bis 5 platziert. Sie bieten den Lesenden Ruhepausen zwischen den teilweise anspruchsvollen theoretischen Ausführungen, indem sie diese anhand konkreter film- bzw. medienhistorischer Beispiele veranschaulichen. Joe Dantes Komödie Matinee (USA 1993, Intermezzo 1), die von einer mit Spezialeffekten überbordenden, zum Zusammenbruch des Kinotheaters führenden Filmvorführung in Zeiten des Kalten Kriegs handelt, versinnbildlicht beispielsweise das Konzept des Bunkers, indem sie zwei verliebte jugendliche Rezipierende in dem im Keller des Kinos eingebauten Bunker Zuflucht finden lässt. Auch die übrigen drei Intermezzi stellen die Selbstreflexivität protektiver Medien heraus.
Casettis Unterfangen einer Screen-basierten Konzeptualisierung bzw. einer topologischen Historiografie protektiver Medien in Screening Fears steht in Tradition seiner gesellschaftsumfassenden Filmtheorie in The Lumière Galaxy. Das Buch ist vor allem dann stark, wenn Casettis Denken gewohnt paradigmatisch wird und den Projektions/Protektions-Komplex zu einem Schlüsselmechanismus unterschiedlicher Dispositive in verschiedenen Phasen der Menschheitsgeschichte erhebt. Umso erstaunlicher ist die nur lose Anbindung an Sloterdijks Sphären-Paradigma, das erst auf S. 120 auftaucht, obwohl es sich mir (und vermutlich auch anderen Lesenden) bereits zu Beginn der Lektüre aufdrängte. Schade finde ich außerdem die fehlende psychologische Differenzierung zwischen Furcht – einer Basisemotion, d. h. einer häufig intensiven, kurzen emotionalen Reaktion auf ein konkretes audiovisuelles Ereignis wie etwa das Erscheinen eines Geistes – und Ängsten. Ängste sind Gefühle wie Liebe oder Hass; sie haben kognitive Anteile und dauern länger an als Emotionen. Über diese kritischen Anmerkungen lässt sich jedoch leicht hinwegsehen, denn Screening Fears besticht durch seine klare Sprache, stringente Argumentation, aufschlussreiche Konzeptualisierung, elaborierte Dramaturgie und – nicht zuletzt in formaler Hinsicht – durch das brillante Lektorat und die ansprechende Aufmachung.
Literatur:
Casetti, Francesco: "The Last Supper in Piazza della Scala". In: Cinéma & Cie 11, 2008, S. 7–14. https://riviste.unimi.it/index.php/cinemaetcie/article/view/16505, abgerufen am 24.03.2025.
Casetti, Francesco: "Back to the Motherland: the film theatre in the postmedia age". In: Screen 52/1, 2011, S. 1–12. https://doi.org/10.1093/screen/hjq049.
Casetti, Francesco: The Lumière Galaxy. Seven Key Words for the Cinema to Come. New York: Columbia University Press 2015.
Sloterdijk, Peter: Sphären. Band I: Blasen. Mikrosphärologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1998.
Sloterdijk, Peter: Sphären. Band II: Globen. Makrosphärologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999.
Sloterdijk, Peter: Sphären. Band III: Schäume. Plurale Sphärologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004.
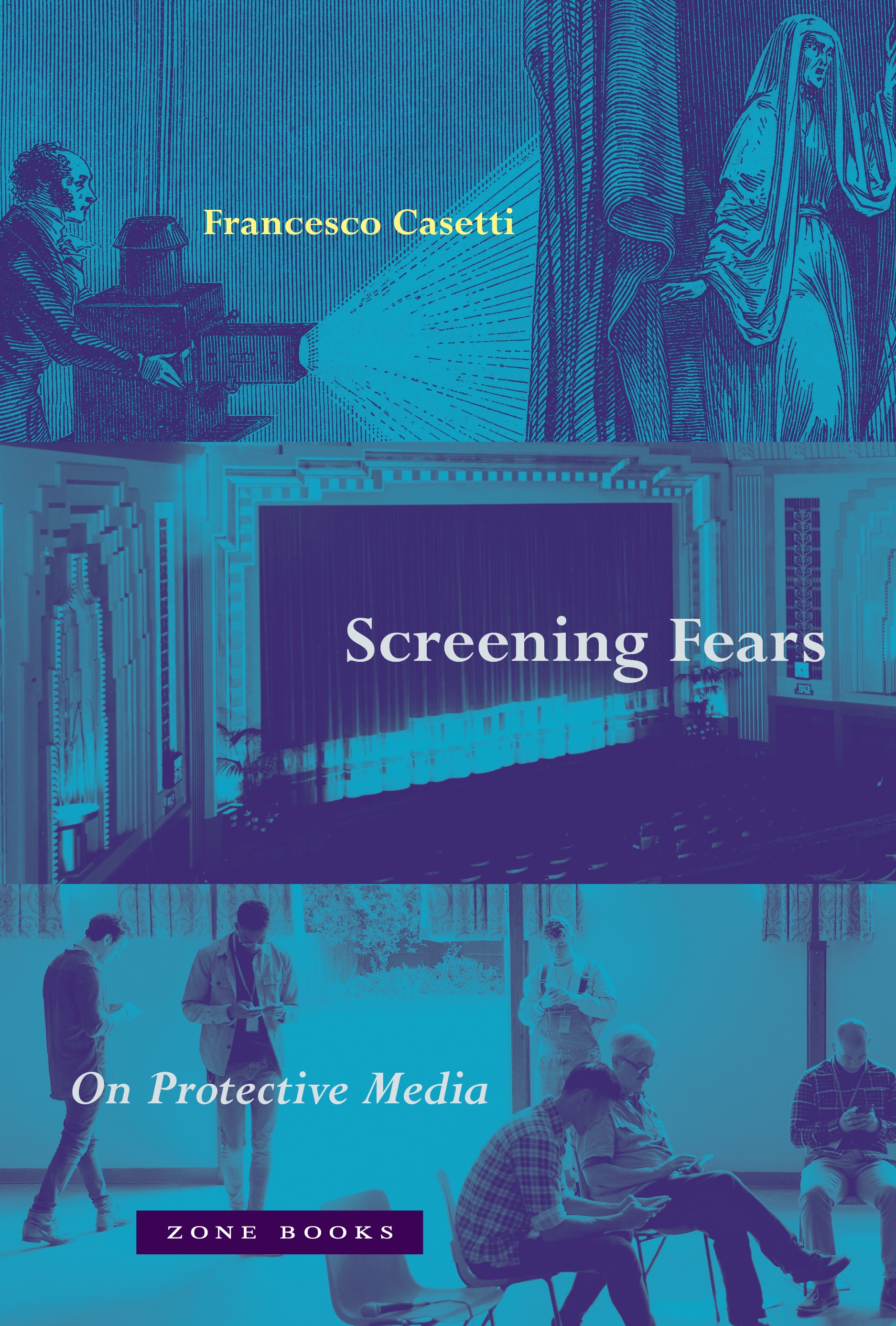
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2025 Johann Pibert

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



