Sassan Niasseri: Shoot 'em in the Head. Eine Film- und Seriengeschichte der Zombies.
Marburg: Schüren 2023. ISBN: 978-3-7410-0432-2. 200 Seiten, 28,00 €.
DOI:
https://doi.org/10.25365/rezens-2024-1-06Abstract
Zombies sind in der Populärkultur nicht totzukriegen, wie die weit gestreuten alltagssprachlichen Verwendungen zeigen: Sie reichen vom Cocktailnamen bis zu wirtschaftlich maroden "Zombiebanken" und auf Smartphones starrenden "Smombies". Der Zombie als Untersuchungsgegenstand ist mittlerweile auch vermehrt Thema wissenschaftlicher Publikationen. Insbesondere im letzten Jahrzehnt sind viele Veröffentlichungen mit unterschiedlichen Ansätzen erschienen. Der Großteil dieser Publikationen verfolgt eher film- und nahe kulturwissenschaftliche Ansätze (u. a. Kleinschnittger 2015, Abbot 2016, Kee 2017, Olney 2017, Ziegler 2017, Wadell 2018, Cameron 2021, Saldarriga/Manini 2022). Einige Publikationen fokussieren Themen wie die pandemische Dimension des Zombiefilms (Kroulík 2021, Laltha 2023) oder setzen einen politikwissenschaftlichen Schwerpunkt (Drezner 2022). Sassan Niasseris neue Monografie Shoot 'em in the Head begleitet den Zombiefilm chronologisch von seinen Anfängen bis in die Gegenwart. Während sich in anderen Publikationen die Filmanalysen häufig einem übergeordneten Thema anpassen, geht Shoot 'em in the Head den umgekehrten Weg. Durch die Beschreibung einzelner Filme werden neue, verbindende Motive eröffnet.
In der Einleitung werden einige grundlegende Begriffe wie die ursprüngliche Bedeutung des Zombies erklärt und eine Abgrenzung zu anderen Monstern der Populärkultur vorgenommen (vgl. S. 27f). Unterteilt in drei größere Abschnitte, werden in chronologischer Reihenfolge Produktionen aus unterschiedlichen Ländern besprochen, wobei der Fokus auf US-amerikanischen Produktionen liegt. Der Umfang die einzelnen Beiträge variiert von mehrseitigen Analysen bis zu kurzen Besprechungen. Ergänzt werden die einzelnen Beiträge durch Interviews mit an der Produktion beteiligten Personen. Diese Interviews sind nicht in kompletter Länge abgedruckt, sondern im Fließtext zu einzelnen Aspekten des jeweiligen Films eingebunden. Eines der Hauptanliegen des Autors ist es, den Zombiefilm in seiner politischen Relevanz hervorzuheben. So würden Zombiefilme stärker als viele andere Horrorfilme gesellschaftliche Spannungen aufarbeiten, wie Niasseri zu belegen versucht.
Erwartungsgemäß großen Raum nehmen die Filme des US-amerikanischen Regisseurs George A. Romero (1940-2017) ein. Mit Night of the Living Dead (US 1968), Dawn of the Dead (US/IT 1978) und Day of the Dead (US 1985) erschuf dieser drei der einflussreichsten Genrebeiträge. Zwar sei Romero nicht der Erfinder der Zombies, aber maßgeblich für die Popularität des Zombies im Film verantwortlich (vgl. S. 22). Er griff dazu eine zeitgenössische Strömung des Horrorkinos auf: Bereits in den 1950er Jahren waren Horrorfilme vor allem durch die Motive der Technikskepsis und Angst vor kommunistischer Invasion und Kollektivismus geprägt (vgl. Kleinschnittger 2015, S. 71).
Niasseri betont auch wiederkehrende Themen, die das Werk von Romero prägen. So etwa ein ambivalenter Rassismusdiskurs. Alles Nicht-Weiße würde auf einer symbolischen Ebene mit Infektion gleichgesetzt, aber selbst weiße Menschen würden durch das Virus ihre zugeschriebenen privilegierten Eigenschaften verlieren (vgl. Kee 2017, S. 53). Auch Medienkritik ist ein fester Bestandteil der Filme von Romero, und besonders diese Sichtweise wurde von anderen Zombiefilmen übernommen, die Medien und deren Berichterstattung (samt sich verselbständiger Panikschleifen) insgesamt als negativ darstellen (vgl. Cameron 2021, S. 50). Vor allem sei Kapitalismuskritik kennzeichnend für das Werk von Romero. Die Kritik von Romero an der (amerikanischen) Konsumkultur lautet überspitzt formuliert: Wer seine Zeit mit sinnlosem Konsum verschwendet, ist der wirkliche Zombie (vgl. Saldarriga/Manini 2022, S. 55). Last but not least, experimentierte Romero mit progressiven Frauenrollen. Day of the Dead wäre fast als Horrorfilm mit einer der progressivsten Frauenrollen in die Filmgeschichte eingegangen. Allerdings überstrahlte der zeitgleich wesentlich erfolgreichere Aliens (James Cameron, US/UK 1986) den Film in dieser Hinsicht (vgl. S. 58).
Mit dem zweiten Kapitel des Buches ("Wanderjahre") ist der Zombiefilm im Bereich des Mainstreamkinos angekommen. Das Subgenre ist in den 1980er Jahren durch immer heftigere Gewaltdarstellungen auch ein Objekt erhöhter behördlicher Aufmerksamkeit. Zusammen mit anderen Horrorfilmen landen viele Filme auf Verbotslisten, die letztendlich deren Bekanntheit nur steigern sollten (vgl. S. 72f). In diesem Zusammenhang schildert der Autor, dass der Zombie zunehmend des ursprünglichen Grusels beraubt wurde. Damit einhergehend findet auch ein Abflachen der kritischen Grundtöne statt. Filme wie The Return of the Living Dead (Dan O'Bannon, US 1985) und Braindead (Peter Jackson, NZ 1992) vermischen Horror mit Comedy. Rückblickend wird gerade an diesen Zombiefilmen kritisch betrachtet, wie sie den weiblichen Körper als erotisiertes Objekt männlicher Befriedigung darstellen und die Frau zu einer Quelle des Horrors transformieren (vgl. Olney 2017, S. 84).
Der Zombiefilm verliert in den 1990er Jahren zunehmend an Bedeutung. Mit Resident Evil (ab 1996) erschien eine populäre Spieleserie vom japanischen Entwicklungsstudio Capcom. Die übergeordnete Handlung der Spiele und ihrer Filmumsetzungen kann auch als kritische Betrachtung von Großkonzernen und deren intransparenter Geschäftsaktivitäten gesehen werden (vgl. S. 102f). Dies sorgte insgesamt für neue Impulse für das Genre.
Um die Jahrtausendwende erlebt der Zombiefilm eine neue Popularität, besonders ausgehend vom Remake von Dawn of the Dead (Zack Snyder, US/FR/JP 2004). Mit diesen Entwicklungen beschäftigt sich das letzte Kapitel des Buchs. Viele Zombiefilme in diesen Jahren thematisieren gegenwartspolitische Entwicklungen wie die Angst vor "Überfremdung", Terrorgefahr und die Zerstörung der Umwelt (vgl. S. 117f). In produktionstechnischer Sicht erreichen Zombiefilme neue Höhen. Mit World War Z (Marc Forster, US 2013) entsteht der bis dahin teuerste Genrebeitrag, ein Film, der auch als wütender Kommentar auf den Spätkapitalismus und seine globalen Verknüpfungen verstanden werden kann (vgl. Olney 2017, S. 77). Der globale Erfolg der Horrorfigur des Zombies zeigt sich auch in einer Reihe von asiatischen Produktionen. Mit der TV-Serie The Walking Dead (US 2010-2022) entsteht außerdem eine der populärsten TV-Serien der letzten Jahre, die den Maßstab von Gewaltdarstellungen im Mainstream-TV verändert hat (vgl. S. 166).
Die Publikation legt anhand von Filmanalysen dar, wie sich die Popularität des Zombies in den letzten Jahrzehnten bis in die Gegenwart entwickelt hat. Leider verpasst das Buch die Chance, wissenschaftliche Literatur stärker in die Analysen einfließen zu lassen. Somit bewegt sich der Inhalt eher zwischen Fandiskursen und Journalismus. Der kulturwissenschaftliche Anteil der Quellen ist in der Minderheit. Das Buch eignet sich daher vor allem für Fankreise und Einsteiger*innen in die Thematik. Vor allem für Filmfans bietet das Buch einen reichhaltigen Fundus, da es sich auch mit einigen Aspekten der Filmproduktion beschäftigt. Dazu tragen vor allem Auszüge aus den Interviews bei.
Im Kontext des globalen Phänomens des Zombies wären tiefere Analysen von Produktionen außerhalb des englischsprachigen Raums – vor allem im asiatischen Raum – interessant gewesen. Weiterführende (wissenschaftliche) Literaturhinweise zum Thema Zombies wären eine wertvolle Ergänzung gewesen, die in der Publikation angegebenen Quellen verweisen überwiegend auf journalistische Onlineportale. Positiv hervorzuheben ist, dass diese Publikation auch als Einstieg in die Thematik dienen kann, vor allem aufgrund der leicht verständlichen Schreibweise. Die Publikation leistet einen Beitrag dazu, ein interessiertes Laienpublikum auf die Komplexität der populär- und alltagskulturellen Figur des Zombies hinzuführen. Für eine konzeptuell rigorosere Auseinandersetzung mit dem Zombie sei hingegen auf die weitere hier zitierte Fachliteratur zum Thema verwiesen.
Literatur:
Abbott, Stacey: Undead Apocalyse. Vampires and Zombies in the 21st Century. Edinburgh: Edinburgh University Press 2016. https://www.cambridge.org/core/books/undead-apocalyse/55D90CBBCB6F71E77E1ADDBDEE5346FB.
Cameron, Allan: Visceral Screens. Mediation and Matter in Horror Cinema. Edinburgh: Edinburgh University Press 2021. https://doi.org/10.1515/9781474419208.
Drezner, Daniel: Theories of International Politics and Zombies. Princeton: Princeton University Press 2022. https://doi.org/10.1515/9780691223520.
Kee, Chera: Not Your Average Zombie. Rehumanizing the Undead from Voodoo to Zombie Walks. New York: University of Texas Press 2017. https://doi.org/10.7560/313176.
Kleinschnittger, Vanessa: Zombie Society. Mediale Modulationen der Figur des Zombies in Vergangenheit und Gegenwart. Baden-Baden: Nomos 2015. https://doi.org/10.5771/9783845265827.
Kroulík, Milan: "Pandemics and Zombies. How to Think Tropical Imaginaries with Cinematic Cosmologies". In: eTropic. Electronic Journal of Studies in the Tropics 20/1, 2021.https://doaj.org/article/b9a7a6ca2e904e0db649e3c5c3743b5c.
Laltha, Samiksha: "Creatures in our bed. Pandemics, posthumanism and predatory nature in World War Z (2013)". In: HTS Teologiese Studies/Theological Studies 79/3, 2023. https://doi.org/10.4102/hts.v79i3.7935.
Olney, Ian: Zombie Cinema. Ithaca: Rutgers University Press 2017. https://doi.org/10.36019/9780813579498.
Saldarriaga, Patricia/Manini, Emy: Infected Empires. Decolonizing Zombies. Ithaca: Rutgers University Press 2022. https://doi.org/10.36019/9781978826823.
Waddell, Calum: The Style of Sleaze. The American Exploitation Film 1959-1977. Edinburgh: Edinburgh University Press 2018. https://doi.org/10.1515/9781474409261.
Ziegler, Daniel: "Zombie-Szenarien und Krisen der Interpretation". In: Kino und Krise. Kultursoziologische Beiträge zur Krisenreflexion im Film. Hg. v. Lim Il-Tschung/Daniel Ziegler, Wiesbaden: Springer VS 2017, S. 31-49. https://doi.org/10.1007/978-3-658-14933-8_2.
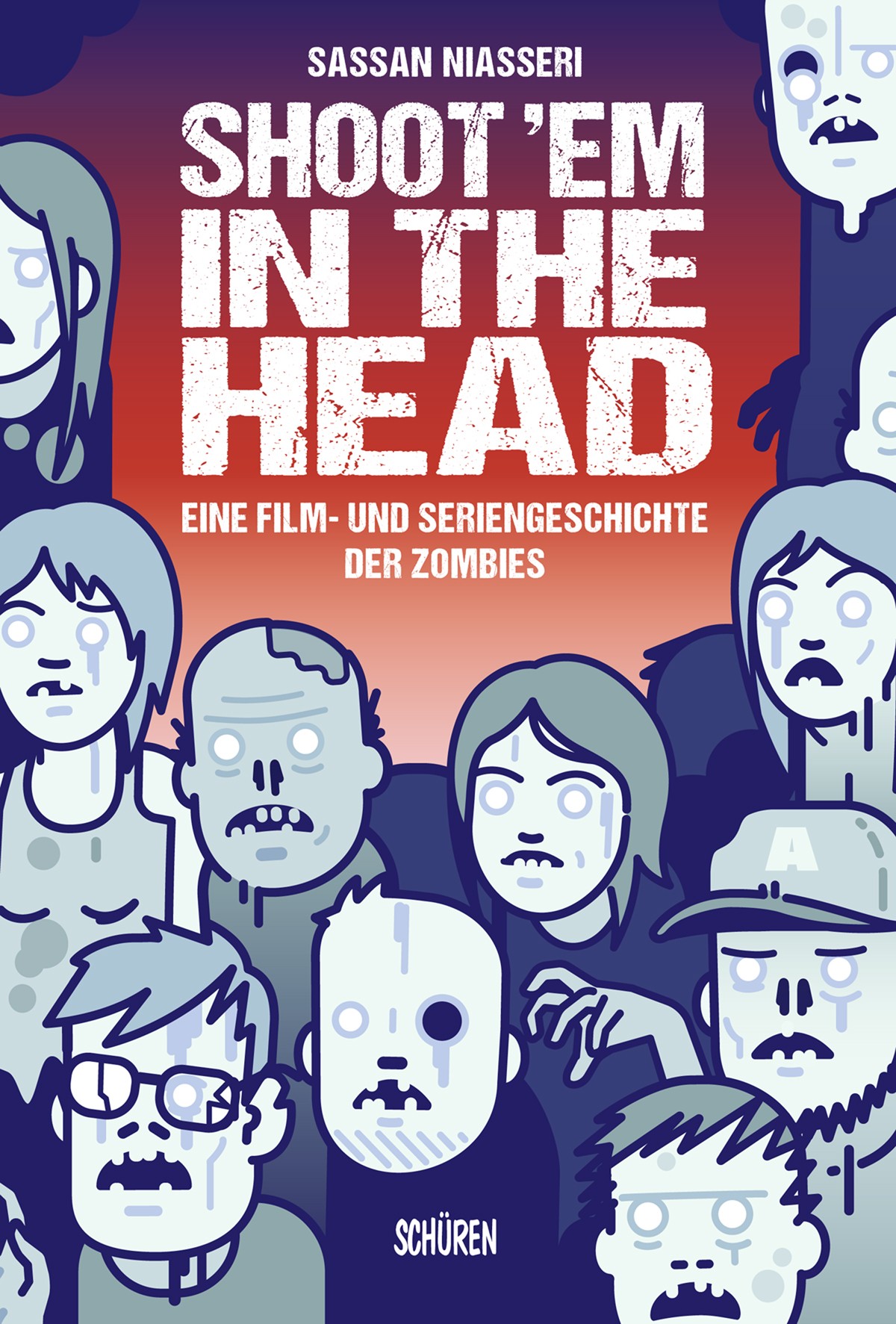
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2024 Angelo Wiesel

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



