Beate Hochholdinger-Reiterer/Christina Thurner/Julia Wehren: Theater und Tanz. Handbuch für Wissenschaft und Studium.
Baden-Baden: Nomos 2023. ISBN 978-3-7489-2855-3. 982 Seiten, 149,00 €.
DOI:
https://doi.org/10.25365/rezens-2025-1-02Abstract
Im Jahr 2023 ein theater- und tanzwissenschaftliches Handbuch erscheinen zu lassen, ließe sich als ein etwas fragwürdiges Unterfangen bezeichnen. Als Publikationsgenre, das – so das grundlegende Paradox – das Wissen einer Disziplin oder eines Felds zugleich möglichst umfassend und knapp zusammenträgt, geht das wissenschaftliche Handbuch in seiner modernen Form auf das späte 19. Jahrhundert zurück. Aus der langen Tradition des Genres entstanden Handbücher damals auch als Gegenstücke zu den neuen, regelmäßig publizierten Zeitschriften, deren schneller Wissenszirkulation sie eine zentrale Sammlung und Ordnung von relevanten Inhalten entgegensetzten (Creager/Grote/Leong 2020, S. 3 f.).
Beim Blick auf die etwa einhundertjährige universitäre Theaterwissenschaft des deutschsprachigen Raums fällt auf, dass diese sich dem Genre gegenüber bislang eher distanziert verhalten hat. Dieser Umstand sieht international betrachtet ganz anders aus: Vermutlich auch, weil die englischsprachige Verlagslandschaft diverse Handbuch-Reihen bereithält, kann man hier etwa auf The SAGE Handbook of Performance Studies (2005), The Methuen Drama Handbook of Theatre History and Historiography (2019) oder das kürzlich erschienene Routledge Handbook of African Theatre and Performance (2024) zurückgreifen.
Im deutschsprachigen Raum hingegen hat als bisher Letzter und Einziger der Kölner Theaterwissenschaftler Carl Niessen ein solcherart betiteltes Projekt aufgenommen. In seinem Handbuch der Theater-Wissenschaft, in drei Bänden zwischen 1949 und 1958 erschienen, konzipierte dieser das Fach als eine global-komparatistische und interdisziplinäre Kunstwissenschaft, die auf ethnografischen Materialien basiert. Die sehr eigenwillige Publikation unterläuft dabei die Konventionen des Genres, indem sie sich als Assemblage verschiedener Quellen zeigt, anstatt einer stringenten Strukturierung und Thesenführung zu folgen und war dabei eigentlich als zehnbändige Reihe in Alleinautorschaft angelegt (Balme 2009; Ellrich 2009). Doch nicht nur Niessens Beitrag zur Handbuchgeschichte ist fragwürdig, gilt er doch als Vordenker des nationalsozialistischen Thingspiels und verfasste er weite Teile des ersten Bandes noch vor 1945 (Annuß 2016). Ungefähr zeitgleich plante auch sein Rivale aus Wien Heinz Kindermann ein Handbuch, und zwar inmitten des Zweiten Weltkriegs und als Teil weiterer, großspurig angelegter Projekte, die allesamt im Dienste der NS-Ideologie standen (Peter 2008, S. 49).
Dieser insofern auch belasteten Vorgeschichte des Genres begegnen die Herausgeberinnen Beate Hochholdinger-Reiterer, Christina Thurner und Julia Wehren (mitgearbeitet haben weiterhin Tabitha Eberli-Zurbrügg, Sari Pamer, Salome Rickenbacher und Julia Wechsler) von Theater und Tanz. Handbuch für Wissenschaft und Studium auf (mindestens) zweierlei Weise: Den ersten Teil des Buchs und somit zentral platziert bildet eine politisch-kritische Skizze der vornehmlich deutschsprachigen Fachgeschichte (Beate Hochholdinger-Reiterer, Christina Thurner). Und davor noch, im Vorwort, betont das Berner Trio, dass ein Handbuch eigentlich nicht ausreicht, um die Inhalte und Zugangsweisen des Fachs ausreichend darzustellen und dass das Vorliegende sich zwingendermaßen mit einer Auswahl begnügen muss.
Was hat es also trotz dieser unumgänglichen Beschränkung weiterhin in das Werk geschafft, das zwar nur in einem Band, als solcher jedoch auf ganzen 982 Seiten von 61,9 MB bzw. 1,726 kg daherkommt? Das Buch gliedert sich in vier Abschnitte, die neben den vorangestellten "Fachgeschichte(n) Theater und Tanz" die Kapitel "Definitionen und Grundbegriffe", "Methoden und Theorien" und "Arbeitsfelder" umfassen, wobei letzteres wiederum in "Geschichte", "Zeitgenössische Formen und Phänomene" und "Ästhetik und Praxis" unterteilt ist. Innerhalb dieser Ordnung ergeben sich freilich Überschneidungen, sowohl zwischen den übergeordneten Kategorien als auch zwischen den einzelnen Einträgen. Nicht immer sind die getroffenen Unterscheidungen sofort einleuchtend. So könnte man sich beispielsweise fragen, warum es sowohl einen Eintrag zu "Methoden der Historiografie" (Jan Lazardzig) gibt als auch solche zu den ebenfalls historiografischen Methoden der "Diskursanalyse" (Constanze Schellow), der "Quellenkritik" oder zu "Vergleich/Transfer" (Isabelle Hafter). In diesem Fall besteht die Lösung darin, dass der Beitrag zu historiografischen Methoden eine übergeordnete Perspektive einnimmt, indem er Themen, Fragestellungen und Herausforderungen vorstellt, anstatt genauer auf das Handwerkszeug einzugehen. Und schließlich muss ein Handbuch nicht nur auswählen, sondern auch (ein)ordnen, wodurch sich im Gegenzug konstruktive Verknüpfungen herstellen lassen, wie es auch in den erwähnten Beiträgen geschieht.
Für die insgesamt 97 Einträge konnten eine Vielzahl von Autor*innen aus dem vornehmlich deutschsprachigen Raum gewonnen werden und erfreulicherweise sind somit nicht nur verschiedene 'Schulen' versammelt, sondern zugleich unterschiedliche Karrierestufen abgebildet. Selbstverständlich ergeben sich mit dieser Heterogenität recht unterschiedlich gelagerte Darstellungsweisen der besprochenen Inhalte. Den Einträgen scheint also keine Einheitlichkeit zugrunde gelegt, was sich kritisieren ließe, letztlich jedoch individuelle Perspektivierungen und spezifische Darstellungen erlaubt.
Auch aktuellere Forschungstendenzen sind im Handbuch Theater und Tanz berücksichtigt. Einträge zu "Diversität" (Peter M. Boenisch), die Einbeziehung digitaler Verfahrensweisen, künstlerischer Formen und Phänomene ("Digital Humanities", Klaus Illmayer; "Theater und Digitalität", Ramona Mosse) sowie insgesamt die Vielfalt der besprochenen Formen und Phänomene sind, etwa im Rückblick auf das Metzler Lexikon Theatertheorie von 2014, als willkommene Gewinne einstufen. Andererseits vermisst man unter den Grundbegriffen die Aufführung oder auch die Inszenierung, zumal ein Beitrag zur Aufführungsanalyse vertreten ist (Christel Weiler). Hinterfragen ließe sich auch, dass die Einträge zur europäischen und zur globalen Theatergeschichte mit je elf Seiten genauso umfangreich sind, ein Umstand, der jedoch sicherlich wiederum dem Genre geschuldet ist. Und auch der im Titel bedachte Tanz kommt keineswegs zu kurz, sondern ist unter anderem mit mehr tanzspezifischen Einträgen vertreten, beispielsweise "Tanzanthropologie" (Daniela Hahn), "Tanztheorien" (Christina Thurner), "Notation" (Claudia Jeschke).
Theater und Tanz, so lässt sich resümieren, ist ein Handbuch, das sich ein wenig davor scheut, als solches daherzukommen: Das Handbuch bleibt ein Handbuch, das zwangsläufig ein- und ausschließt und eine gewisse Kanonbildung nahelegt. In dieser Vorgabe des Genres und zugleich in der materiellen Begrenzung eines einbändigen Buches begreift es sich jedoch als explizit offen angelegt, sei es durch die Formulierung von Desideraten, Herausforderungen oder Ausblicken, mit denen viele Einträge enden, oder durch die wiederholten Hinweise auf die notwendigen Selektionen und Setzungen. Immer wieder werden Überschneidungen aufgezeigt und auf die Unabgeschlossenheit des Vorhabens, auf seine Zeit-, Standpunkt- und Kontextgebundenheit verwiesen, während die Herausgeberinnen auch den Wunsch nach ergänzenden Anregungen vorbringen. Auch angesichts dieser immer wieder selbst eingeräumten Kritik am Genre wäre ein etwas ausführlicherer Einblick in das Entstehen des Handbuchs interessant gewesen: Wie kamen die Kategorien zustande? Welche sind herausgefallen und warum? Gab es Austausch zwischen denjenigen Autor*innen, die überschneidende Themengebiete behandeln? Gleichwohl erfüllt Theater und Tanz zweifellos das, was es im Untertitel verspricht: Es ist ein äußerst nützliches, dabei gut lesbares und 'handhabbares' Handbuch für Wissenschaft und Studium.
Literatur:
Annuß, Evelyn: "Wollt ihr die totale Theaterwissenschaft?". In: Episteme des Theaters. Aktuelle Kontexte von Wissenschaft, Kunst und Öffentlichkeit. Hg. v. Milena Cairo/Moritz Hannemann/Ulrike Haß/Judith Schäfer, Bielefeld: transcript 2016, S. 635–647. https://doi.org/10.1515/9783839436035-046, abgerufen am: 02.10.2024.
Balme, Christopher: "Carl Niessen: Handbuch der Theater-Wissenschaft". In: Forum Modernes Theater 24/2, 2009, S. 183–189. https://elibrary.narr.digital/article/99.0000/fmth200920183, abgerufen am: 02.10.2024.
Creager, Angela N. H./Mathias Grote/Elaine Leong: "Learning by the Book: Manuals and Handbooks in the History of Science". In: BJHS Themes 5, 2020, S. 1–13. https://doi.org/10.1017/bjt.2020.1, abgerufen am: 02.10.2024.
Ellrich, Lutz: "Carl Niessens Handbuch der Theater-Wissenschaft. Versuch einer ethnologischen Relektüre". In: Maske und Kothurn 55/1-2, 2009, S. 175–192.
Hochholdinger-Reiterer, Beate/Christina Thurner/Julia Wehren (Hg.): Theater und Tanz. Handbuch für Wissenschaft und Studium. Baden-Baden: Nomos, 2023.
Peter, Birgit: "'Wissenschaft nach der Mode'. Heinz Kindermanns Karriere 1914-1945. Positionen und Stationen". In: "Wissenschaft nach der Mode"? Die Gründung des Zentralinstituts für Theaterwissenschaft an der Universität Wien 1943. Hg. v. Birgit Peter/ Martina Payr, Wien: Lit 2008, S. 15–51.
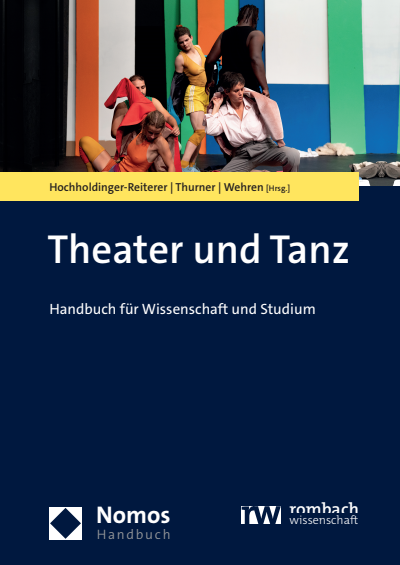
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2025 Lotte Schüßler

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



