Annie Bourneuf: Im Rücken des Engels der Geschichte.
Leipzig: Merve 2024. ISBN: 978-3-96273-081-9. 256 Seiten, 22,00 €.
DOI:
https://doi.org/10.25365/rezens-2025-1-11Abstract
Etwas Neues im Alten zu finden – mit dieser Aufgabe konfrontiert sich die Kunsthistorikerin Annie Bourneuf in ihrem neuen Buch über Paul Klees Aquarell Angelus Novus. Das Bild, das Klee im Jahr 1920 fertigstellte und das bereits im selben Jahr von Walter Benjamin erworben wurde, begleitet eine intensive philosophische Auseinandersetzung, ohne die Bourneufs neue Beschäftigung, wie sie selbst anmerkt, wohl nur sehr wenige Leser*innen gefunden hätte (vgl. S. 195). Aber nicht nur die viel besprochenen Verbindungen zwischen Klees Bild und Benjamins Arbeiten, Briefen und insbesondere den Thesen "Über den Begriff der Geschichte" (1977) nimmt Bourneuf zum Anlass für die erneute Befragung und Interpretation des Bildes. Vor allem weckte eine überraschende Entdeckung der Künstlerin R. H. Quaytman Bourneufs Interesse. Diese Entdeckung wird Ausgangspunkt für Bourneufs Neuauslegung des Angelus Novus, des benjamin‘schen Engels der Geschichte, die 2024 in deutscher Übersetzung im Merve Verlag erschienen ist.
Im Rücken des Engels der Geschichte befindet sich nicht nur die Zukunft, zu der es den Engel hindrängt, wie es in Benjamins geschichtsphilosophischen Thesen über das Klee-Bild heißt (vgl. Benjamin 1977, S. 698), sondern auch ein Kunstdruck. Im Zuge der Vorbereitungen für eine Ausstellung in Tel Aviv untersuchte R. H. Quaytman das Bild, das bisher nur sehr wenige im Original gesehen hatten, genauer und bemerkte: Am Rand des Bildes – sichtbar nur in wenigen Abbildungen des Aquarells – lässt sich eine Jahreszahl und ein Monogramm (LC) entziffern. Nachdem Quaytman sich an Bourneuf gewandt hatte, um Genaueres über dieses Bild in Erfahrung zu bringen, konnten Quaytman und Bourneuf beim Anschauen des Originals in Jerusalem noch mehr Hinweise feststellen. "1521, LUCAS CARNACH PINX" stand auf der linken, "FR: MÜLLER SCULPS" auf der rechten Seite (S. 13). Diese Inschrift, die entweder Klee oder einer der Vorbesitzer (Benjamin, Theodor W. Adorno, Gershom Scholem) entfernte, markiert den Beginn einer Entdeckungsgeschichte von Quaytman und Bourneuf, die im ersten Kapitel nacherzählt wird. Klee hatte die verschiedenen Blätter, auf denen der Angelus Novus zu sehen ist, über eine von Friedrich Müller 1838 angefertigte Kopie eines Porträts Martin Luthers, das 1521 von seinem Chefporträtisten Lucas Cranach angefertigt wurde, montiert. Von der Entdeckung dieses Details geht Bourneuf aus, um die Entdeckungsgeschichte zu dokumentieren, die religionstheoretischen und kunsthistorischen Implikationen herauszuarbeiten und Klees sowie Benjamins Beschäftigung mit dem Angelus mit dem Luther-Bild zu verbinden. Auch wenn, wie Bourneuf schreibt, Klee dieses Bild nicht mit der Absicht überdeckte, besondere Aufmerksamkeit darauf zu lenken, und gleichzeitig nicht davon ausgegangen werden kann, dass Benjamin von dem Bild gewusst hat, nimmt Bourneuf doch an, dass "Klee [gewollt hätte], dass wir Vermutungen darüber anstellen [was sich dahinter verbarg]" (S. 17). Und was Benjamin betrifft, so ist sein Interesse für jene kunsthistorischen Arbeiten, "die sich mit den vorgeblich 'unbedeutenden' und 'unsichtbaren' Aspekten von Kunstwerken auseinandersetzen" (S. 15), im Kontext der Neuentdeckungen kein Ausgangspunkt für eine Revision gängiger Arbeiten zum Angelus-Komplex. Benjamins Gespür für scheinbar Unbedeutendes liefert aber doch ein Argument für das Weiterführen der kulturwissenschaftlich-philosophischen Beschäftigung mit einem nun mehr über hundert Jahre alten Bild.
In drei Kapiteln und einem gewichtigen Nachwort präsentiert Bourneuf die Entdeckungsgeschichte von R. H. Quaytman (überschrieben mit der Jahreszahl der Entdeckung "2015"). Gefolgt von einer kunsthistorischen Einordnung über die Renaissance bis zur Avantgarde (überschrieben mit der Jahreszahl der Fertigstellung des Bildes "1920") und einer theoretischen Neujustierung des Bildes von Benjamin über Ernst Bloch, Martin Buber und Scholem (überschrieben mit der Jahreszahl "1922", dem Jahr, in dem Benjamin seine nie erscheinende Zeitschrift mit dem Namen Angelus Novus ankündigt). Vom Staunen über die bisherige Verborgenheit des Luther-Porträts ausgehend, überlegt Bourneuf zuerst, ob das Aquarell eine Reverenz für die Unterlage bedeutet oder ob es sich eher um eine Entstellung des Luther-Kupferstichs handelt (vgl. S. 26f). So ist es zumindest frappant, dass Klee, der öfter die Rückseiten von Kupferstichen als hochwertiges Papier verwendete, den Angelus über die Vorderseite des Luther-Bildes montierte. Ist dieses Bild also ein Kommentar zur jüdisch-deutschen Geschichte?
Ein Bild, das die Ikone des Protestantismus überdeckt, um darüber einen Engel zu zeigen, scheint für den Kunstdiskurs der 1920er-Jahre – der den Protestantismus als Sargnagel der Kunst beschrieb – eine mögliche Wiederverzauberung der Welt anzudeuten (vgl. S. 99ff). Im zweiten Kapitel liest Bourneuf den Engel als polytheistische Figur, der als Chiffre für Hoffnung in scheinbar ausweglosen Zeiten steht. Untrennbar mit der Geschichte der Judenverfolgung und dem Fortleben theoretischer Strömungen des 21. Jahrhunderts verbunden, schwebt der Engel so vor seiner eigenen Geschichte und löst sich zwangsläufig von intentionalen Interpretationen. Schon Benjamins "IX. These", in der er sich auf den Angelus Novus bezieht, liest sich, wie Bourneuf hervorhebt, als "anti-anschauliche" (S. 66) Beschreibung und damit als Versuch, sich von Klees schöpferischer Deutungshoheit zu lösen.
Im dritten Kapitel – und erst mit dem Bild hinter dem Bild – eröffnet sich schließlich für Bourneuf eine breite kunsthistorische Dimension. Bourneuf stellt den Angelus nicht nur in eine Traditionslinie mit Albrecht Dürrers Melancholia 1 und Matthias Grünewalds Isenheimer Altar, mit denen sich auch Benjamin schon beschäftigte (vgl. S. 126), sondern auch in eine Beziehung zum Avantgarde-Vandalismus und zu Quyatmans aktuellen künstlerischen Bezugnahmen. Bourneuf argumentiert, dass sich Kunstwerke von den Intentionen ihrer Schöpfer*innen entfernen sollten; das gilt insbesondere für Klees Arbeiten, da er eine solche Auseinandersetzung explizit begrüßt (vgl. S. 34). Dies legitimiert nicht nur Benjamins breite Diskussion des Bildes, wie etwa in dem von Bourneuf oft zitierten Briefwechsel mit Scholem, sondern löst das Bild auch aus der "eingefahrenen Diskussionsrolle" (S. 195).
In ihrem Nachwort zitiert Bourneuf Scholems Vortrag "Benjamin und sein Engel", in dem dieser an die Vielschichtigkeit des Mystischen in Benjamins Denken erinnert – und damit ein Versäumnis in der Benjamin-Exegese beklagt (vgl. S. 205). Nicht nur die Vielschichtigkeit von Benjamins Angelus Novus-Denkbild, sondern auch die materielle Vielschichtigkeit aus Papier und Karton vergegenständlichen eine Verschränkung und bereiten einen Horizont, in dem "das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation zusammentritt" (Benjamin 1977, S. 576; vgl. S. 200) Auch wenn für Bourneuf – obwohl sie diese Stelle mit dem Angelus zusammenbringt – der Angelus Novus keine Exemplifizierung eines dialektischen Bildes im Sinne Benjamins ist, hält er doch etwas verborgen, was erst in der Jetztzeit aufblitzt. Für die Beschäftigung mit Benjamin und seinen aktuell bleibenden geschichtsphilosophischen Überlegungen ist Bourneufs Buch ein Ausgangspunkt, an den es anzuschließen gilt. Es scheint in dem alten Bild und hinter dem alten Bild etwas Neues auf uns gewartet zu haben.
Literatur
Walter Benjamin: "Über den Begriff der Geschichte". In: Gesammelte Schriften. Bd. I. Hg. v. Rolf Tiedemann/Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1977, S. 691-704.
Walter Benjamin: "N [Erkenntnistheoretisches, Theorie des Fortschritts]". In: Gesammelte Schriften. Bd. V. Hg. v. Rolf Tiedemann. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1977, S. 570-611.
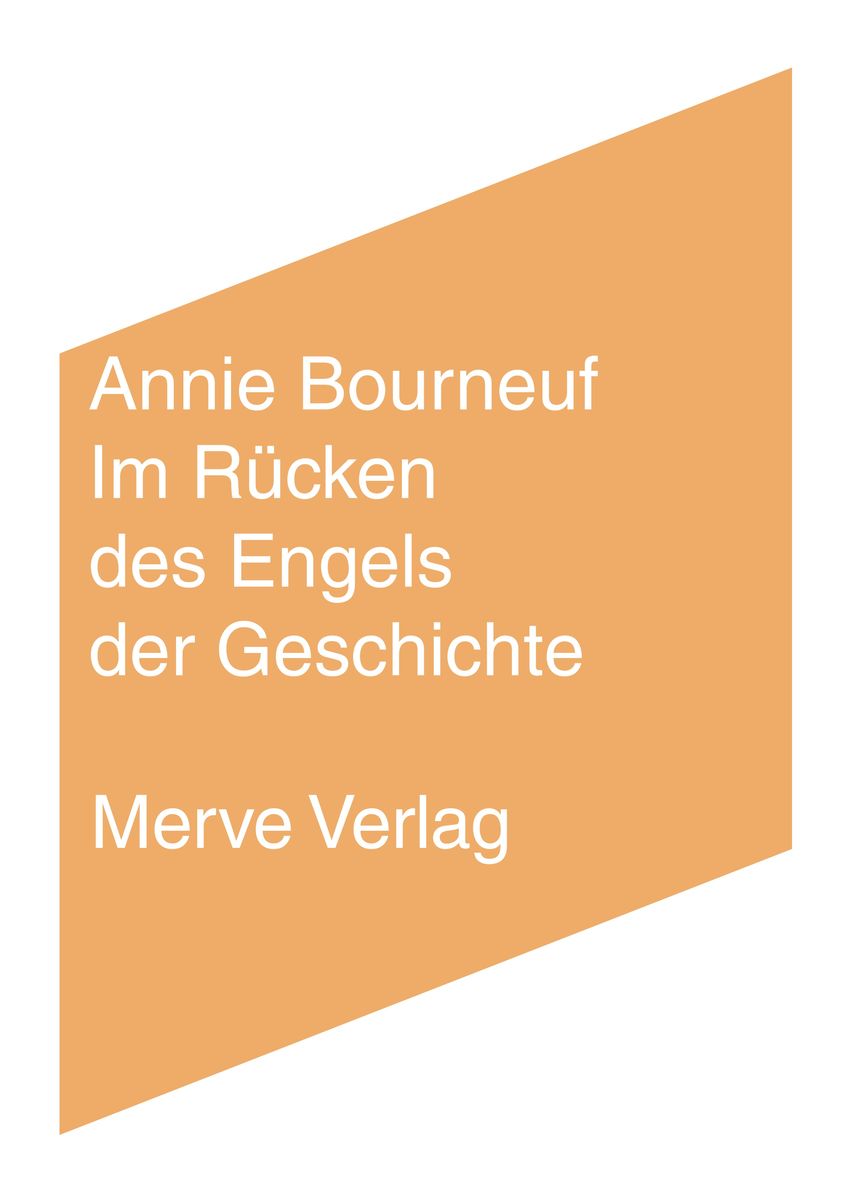
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2025 Gideon Hempel

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



