Sabine Päsler-Ehlen: Krise und Reform als bürgerliches Projekt. Institutioneller Wandel der Hoftheater (1780–1880).
Berlin: Springer 2024. ISBN: 978-3-662-68485-6. 513 Seiten, 123,35 €.
DOI:
https://doi.org/10.25365/rezens-2025-1-04Abstract
Man kann sich Eduard Devrient richtig dabei vorstellen, wie er 'sein' Theater leitet – wie er Dramen liest und einrichtet, mit dem Ensemble probt, Kostüme inspiziert und mit dem Hof über die Ausgestaltung seiner Tätigkeit verhandelt. Der große Schauspieler und Theaterleiter des 19. Jahrhunderts wird in Sabine Päsler-Ehlens Buch Krise und Reform als bürgerliches Projekt. Institutioneller Wandel der Hoftheater (1780–1880) zum Dreh- und Angelpunkt eines Nachdenkens über institutionelle Veränderungsprozesse an den deutschen Hoftheatern. Dabei nimmt die 2023 eingereichte Dissertation die Ägide seiner Theaterdirektion am Karlsruher Hoftheater in den Jahren 1852 bis 1869 stellvertretend für das Reformpotenzial der Hofbühnen in den Blick.
Ausgangsgedanke der Arbeit ist, dass im 19. Jahrhundert beständig die Dauerkrise des Theaters besungen wurde und es dabei nie an Reformvorschlägen fehlte, wie der ewige Theaterschlendrian zu beheben sei. Das zeigt die Autorin bereits in der Einleitung mittels des Close Readings eines Lexikonartikels zum Thema "Verfall des Theaters" von 1841. Sie spannt dann die beiden zentralen Begriffe "Krise" und "Reform" auf, anhand derer sie ihre Fragestellung entwickelt: Ihr geht es darum, zu untersuchen, "inwiefern das Narrativ von Krise und Reform im Wechselverhältnis mit der Idee eines aufklärerisch-bürgerlichen Bildungstheaters steht und wie dieses Wechselverhältnis in Diskurs, Ordnung und Praxis des Theaters im Laufe des 19. Jahrhunderts als bürgerliches Projekt zum Ausdruck kommt." (S. 11, kursiv i. O.) Sie legt dafür den Fokus auf die Positionen der Regie und der Bühnenleitung, die sie als "zentrale Gelenkstelle" (S. 11) für die Verbürgerlichung der Hoftheater und die Professionalisierung der Theaterpraxis betrachtet.
Theoriestark wie bereits andere theaterhistoriografische Arbeiten aus dem Umfeld des Kölner Instituts für Medienkultur und Theater verschaltet Päsler-Ehlen hierfür unter anderem Konzepte des New Institutionalism mit dem Begriff der Zirkulation. So will sie greifbar machen, wie Krisenerzählungen und die mit ihnen verbundenen Reformvorschläge auftauchten, sich transformierten und über politische Zäsuren wie die Revolution von 1848 hinweg präsent blieben. Die Krise fungiert dabei als Motor und Vergrößerungsglas für die Prozesse der Umstrukturierung der Institution Hoftheater. Es geht ihr aber explizit nicht darum, den institutionellen Wandel anhand radikaler Brüche zu erzählen, eher macht sie den Versuch, langsame Veränderungen in der Alltäglichkeit des Betriebs zu beobachten.
Nach der Einleitung und einem Kapitel zum zeithistorischen Kontext präsentiert sie ihre Ergebnisse im Hauptteil in den drei Blöcken "Diskurs", "Ordnung" und "Praxis". Mittels der Diskursanalyse wertet sie hierfür in Kapitel 3 verschiedene Denkschriften zum Reformpotenzial des Theaters aus. Sie zeigt auf, welche Vorstellungen von Theater Mitte des 19. Jahrhunderts zirkulierten und mit welchen Reformideen sie verbunden waren. Hierfür diskutiert die Autorin zuerst sechs Texte aus der Zeit der 1840er-Jahre und arbeitet heraus, dass die Ideen der Vormärzdenker bürgerliche wie monarchistische Elemente enthielten: Einerseits knüpfte ihre Vorstellung von Theater an ein aufklärerisches Ideal an. Theater wurde als Bildungs- und Nationaltheater gedacht und sollte durch die Herausbildung nationaler Dramatik zum nation building beitragen. Hieraus speiste sich auch der Vorschlag, die Theater administrativ aus der Einflusssphäre der Höfe herauszulösen. Nicht die Willkür des fürstlichen Geschmacks, sondern bürgerliche Ideale wie Vernunft und Freiheit sollten handlungsleitend werden. Andererseits stärkten die Reformer in ihren Texten die Bühnenleitung als zentrale Figur dieses Wandels. Es sollten nicht länger die sogenannten "Kavaliersintendanten" die Theater leiten, sondern bürgerliche Fachmänner. Diese sollten weitreichende Kompetenzen in sich vereinen – Formen kollektiver Leitung konnte es nur in der milden Form einer Beratung durch Ausschüsse geben. Offenbar trauten die Reformer dem Theater noch nicht zu, sich eigenständig zu regulieren, weshalb höfische Tugenden auch weiterhin das Richtmaß der Leitung bleiben sollten.
Eine "Bildung des Volkes 'von oben'" (S. 106) nennt Päsler-Ehlen diese starke Zentrierung auf eine Führungsfigur. Sie manifestierte sich auch in den ästhetischen Debatten der Reformschriften: Ein Theaterverständnis, das text- und nationszentriert funktionierte, führte zur Forderung nach Einheitlichkeit in der Darstellung und einer auf Natürlichkeit ausgerichteten Spielweise, welche wieder durch die Bühnenleitung und die Regie sichergestellt werden sollten. Hierzu sollten die Schauspielausbildung und die Probenpraxis verbessert werden. Zwar ließen sich diese Reformideen in den Jahren des Vormärz nicht durchsetzen, doch blieben sie zwischen 1849 und 1881 präsent, wie Päsler-Ehlen im zweiten Teil des Kapitels anhand von rund 20 Reformschriften darlegt. Auch hier tauchten Krisennarrative vom gefährlichen Virtuosentum, der Putzsucht in der Ausstattung und der Unfähigkeit der Theaterverwaltung auf, auch hier beantwortete man sie mit einer Forderung nach einem mächtigen Leiter, der mit utopischen Erwartungen überfrachtet und zum "Direktionsgenie" (S. 177) stilisiert wurde.
Welche Reformen sich tatsächlich umsetzten, lotet Päsler-Ehlen unter dem Block "Ordnung" in Kapitel 4 hinsichtlich der administrativen Strukturen am Beispiel der Karlsruher Hoftheater aus. Sie wählt dazu einen mikrohistorischen Ansatz und zieht neben den Dienstinstruktionen des Theaters Eduard Devrients Tagebücher sowie Schriftwechsel zwischen ihm und dem Hofdomänenintendanten Wilhelm Franz von Kettner heran. Kapitel 4 ist aufgrund des tollen Quellenmaterials das interessantes und dichteste Kapitel der Arbeit: Der Frust Devrients über die ständige Einmischung seines höfischen Gegenspielers gibt Päsler-Ehlen dankbares Futter, um die ersten Direktionsjahre Devrients als permanenten Machtkampf zwischen bürgerlichem Fachmann und standesbezogenem Adeligen zu erzählen. Dabei hatte seine Direktion vielversprechend begonnen: In einer Dienstinstruktion verzichtete man darauf, ihm einen Intendanten zu überstellen und sprach ihm weitreichende Rechte in Kunst- und Personalfragen zu, lediglich bei der Abrechnung war er an die Organe des Hofes gebunden. Dennoch nahm sich Hofdomänenintendant von Kettner als Devrient übergeordnet wahr und griff regelmäßig in dessen Kompetenzbereich ein.
Eindrucksvoll arbeitet die Autorin heraus, wie in Devrient und von Kettner zwei Welten aufeinanderprallten: Devrient zeichnet sie als Exponenten einer bürgerlichen Logik nach. Leistungsorientiert und vernunftbetont argumentierte er im Kampf um 'sein' Theater rein mit Blick auf die Sache. Operiert wurde im Modus der Mündlichkeit, Hierarchien wurden nicht immer gewahrt. Kettner erscheint demgegenüber als Vertreter der höfischen Logik: standesorientiert und auf die Einhaltung von Hierarchien bedacht, missbilligte er Devrients Versuche, im direkten Kontakt mit dem Prinzregenten seine Interessen durchzusetzen, und bestand auf die Schriftlichkeit als angemessene Verkehrsform. Dabei war von Kettners Agieren von der Angst vor einem Privilegienverlust und vor einer "feindliche[n], bürgerliche[n] Kolonisierung" (S. 282) des Theaters geprägt. Eine Verbürgerlichung des Karlsruher Theaters gelang am Ende dennoch: Nach einer Änderung der Dienstinstruktion zu Devrients Gunsten entfaltete sich zwar ein neuer Machtkampf, im Mai 1858 erfolgte jedoch ein Rücktritt von Kettners. Devrients Direktion blieb zunächst so krisenbehaftet, dass auch er seine Entlassung erbat. Diese wurde durch den Hof aber abgewendet, nach vielen erfolgreichen Direktionsjahren ernannte man ihn 1869 zum Generaldirektor des Theaters. Päsler-Ehlen sieht in seiner Ägide ein gelungenes Beispiel dafür, wie die Krise zum Movens institutioneller Veränderung der Theater werden konnte. Gleichzeitig betont sie, dass deren Gelingen im 19. Jahrhundert noch stark von der Figur des Fürsten abhängig war.
Diese Abhängigkeit schreibt sich im letzten Block der Arbeit unter dem Stichwort "Praxis" fort, der die Kapitel 5 bis 7 einnimmt und Theaterreformbestrebungen anhand der Repertoiregestaltung und der Probenpraxis dingfest machen will. Im knapp gehaltenen Kapitel 5 leistet Päsler-Ehlen Theoriearbeit, um in die Methode der historischen Praxeologie einzuführen. Diese verwendet sie in Kapitel 6 für vier kurze Fallstudien aus den Jahren 1779 bis 1846, die wie ein Vorspann für das ausführlichere 7. Kapitel erscheinen, in dem erneut das Karlsruher Hoftheater im Fokus steht. Anhand der Dalberg-Bühne in Mannheim, Goethes Theaterleitung in Weimar, Eduard Devrients Oberregie am Dresdener Hoftheater und der Leitung des Zürcher Stadttheaters durch Charlotte Birch-Pfeiffer diskutiert die Autorin, welche Reformpotenziale sich bis Mitte des 19. Jahrhunderts mit Blick auf die Professionalisierung der Probenarbeit und der Repertoiregestaltung an den Theatern ergaben. Sie zeigt, dass eine "erfolgreiche Verbürgerlichung der Institution Hoftheater" (S. 357) in dieser Zeit noch nicht gelang, da in den höfisch geprägten Strukturen Reformvorhaben oft versandeten – demgegenüber genoss Charlotte Brich-Pfeiffer an einem Privattheater strukturell bessere Bedingungen zur Umsetzung von Reformen.
In Kapitel 7 ist es dann wieder Devrient, dem die Leserin bei der Arbeit zusieht. Päsler-Ehlen veranschaulicht, dass sich eine Professionalisierung des Karlsruher Hoftheaters bereits in der Einführung eines Lesekomitees realisierte. Es diente der Sondierung zahlreicher Dramen, die dem Theater eingesandt wurden. Die Aufführungstauglichkeit und die Suche nach einer nationalen Dramatik wurden hierbei zur Richtschnur des Komitees. Zudem fungierte das Komitee auch als eine Leseschule für die beteiligten Regisseure. In den Spielplan flossen nur wenige der so begutachteten Texte ein, doch steht die Geschmacksbildung durch Lektüre und Diskussion wieder ganz im Zeichen der von Päsler-Ehlen diskutierten Verbürgerlichung der Hoftheater. Diese macht sie mit Blick auf das Repertoire unter Devrient vor allem an mehreren Zyklus-Aufführungen der 1860er-Jahre fest. Über Zyklen zu den Werken Shakespeares oder zum deutschen Drama wurden Klassiker erst kanonisiert. Der Mehrwert dieser Aufführungen lag nicht in der Neuheit der Texte, sondern in ihrer wiederholten Aufführung – ein "Novum" (S. 375) für Karlsruhe. Dass die Dramen des 19. Jahrhunderts nicht als abgeschlossenes Werk, sondern als offene Baustelle betrachtet wurden, argumentiert die Autorin einleuchtend anhand der Zusammenarbeit von Devrient und Gustav Freytag. Vom erstem Entwurf eines Stückes bis zu dessen Aufführung gingen zahlreiche Briefe mit Änderungsvorschlägen hin und her, Passagen wurden umgeschrieben, auf ihre praktische Bühnentauglichkeit getestet und noch nach der Premiere in das Drama eingespeist. Die Autorin wirbt deshalb dafür, die Dramenproduktion der Zeit im Sinne eines "fluiden Werkes" (S. 403) zu verstehen.
Im letzten Teil des 7. Kapitels nimmt sie die Probenarbeit in den Blick, wobei die Quellenlage hier stellenweise etwas dünn ist. Dennoch kann sie herausarbeiten, dass das Proben unter Devrient eine professionalisierte Form bekam: Zu Beginn standen sog. "Vorlesungen", Vorläufer der heutigen Leseprobe. Sie fanden teilweise auch vor einem interessierten Publikum bei Devrient zuhause statt und sollten das Bürgertum mit den Texten vertraut machen. In Einzelproben mit den Darsteller*innen wurde an der Vortragsweise gefeilt, wobei Devrient einem auf Natürlichkeit und Innerlichkeit beruhenden Schauspielideal nacheiferte. Zudem sollte durch die Wahl des Kostüms nicht nur die Wirkung des Textes sondern auch die Sittlichkeit des Schauspielerstandes gefördert werden. In den wenigen Bühnenproben ging es schließlich darum, die Gesamtwirkung der Darstellung sicherzustellen. Dass Devrient nie zum Endpunkt seiner Bestrebungen eines harmonischen Gesamteindrucks gelangte, belegt Päsler-Ehlen anhand seiner Tagebücher: in ihnen dokumentiert sich auch nach 15 Jahren an der Spitze des Theaters die Enttäuschung darüber, dass eine Erziehung zu natürlichem Spiel und Ensemblearbeit nur bedingt klappte.
Insgesamt liest sich Päsler-Ehlens 513 Seiten starke Dissertation äußerst überzeugend, denn sie führt eindrucksvoll vor Augen, wie eine Institutionsgeschichte funktionieren kann, die Personen betrachtet, "die trotz einer weniger aufsehenerregenden, revolutionären Praxis innerhalb der Institution gewirkt und diese geprägt haben." (S. 484) Besonders die detaillierten Analysen der Kapitel 4 und 7 zeigen, dass Reformen des Theaters nicht nur diskutiert, sondern unter ständigen Vor- und Zurückbewegungen mit je eigenen Mikrokrisen tatsächlich implementiert wurden, obschon nicht alle Reformvorhaben ihr Potenzial entfalteten. Dennoch verliert das methodisch so gut gemachte Buch etwas durch seine enorme Länge. Dabei gäbe es im Umgang mit Quellen Kürzungspotenzial: oft wiederholt Päsler-Ehlen den Inhalt der Zitate ausführlich in eigenen Worten und dehnt vereinzelt auch die Deutungselastizität der Quellen stark aus. Hinsichtlich ihres Vorgehens, graduelle Veränderungen in ihrer Kleinteiligkeit zu untersuchen, ist das verständlich, doch würde eine sanfte Kürzung der Stärke ihrer Argumentation keineswegs entgegenstehen. Alles in allem gelingt Päsler-Ehlen aber trotz – oder gerade wegen? – der Länge ein spannender Einblick in das Räderwerk des Theaters im 19. Jahrhunderts, der hoffentlich viele Leser*innen findet.
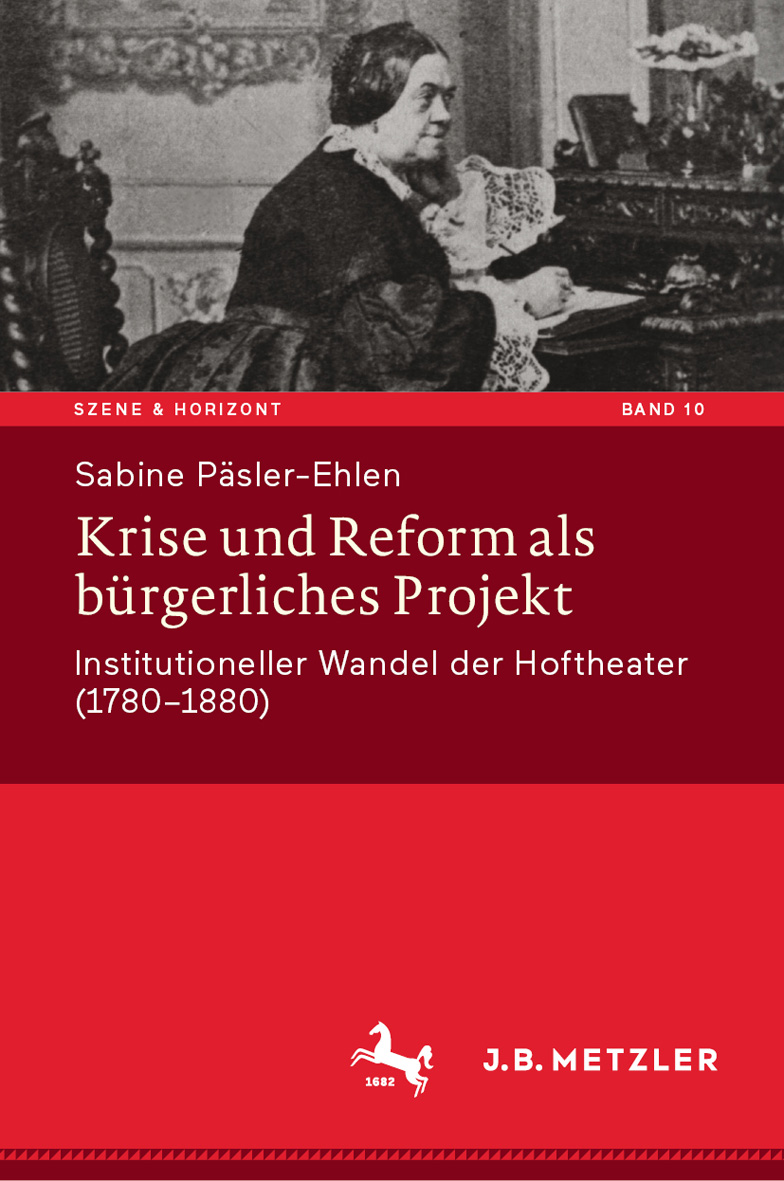
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2025 Carolina Heberling

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



