Julia Leyda: Anthroposcreens Mediating the Climate Unconscious.
Cambridge: Cambridge University Press 2023. ISBN: 9781009317702. 75 Seiten, 19,84 €.
DOI:
https://doi.org/10.25365/rezens-2025-1-09Abstract
Wer sich vor Augen führt, dass Europas größter Ölproduzent Norwegen seine Industrie bis jetzt weder in Filmen noch in Serien behandelt hat, kommt, wie Julia Leyda, nicht umhin, zu fragen: "Where was their Dallas[?]" (S. 1). Diese Frage entwickelt sie aus ihrer eigenen Situierung heraus, denn seit 2016 lehrt sie an der Norwegian University of Science and Technology in Trondheim als Professorin für Filmwissenschaft. Neben der Verwunderung darüber, dass es in Norwegen kaum Filme oder Serien über die Ölindustrie gibt, leitet sich die zweite Frage aus ihrer persönlichen Frustration ab, jedes Semester sehen zu müssen, wie Dennis Quaid in The Day After Tomorrow (2004) seinen Sohn rettet: "Surely, White Americans cannot be the only people in the United States affected by climate crisis[.]" (S. 1) Damit ist auch schon das Untersuchungsfeld umrissen, das sich aus "contemporary Black American and Norwegian films and television series" (S. 1) zusammensetzt und damit einen erfrischenden Blickwechsel für die Forschungen zur cli-fi (climate fiction vgl. Svoboda 2016, Leikam/Leyda 2017) ermöglicht.
Nun hat Leyda nach einer Reihe an Aufsätzen zur cli-fi mit Anthroposcreens. Mediating the Climate Unconscious eine eigenständige, wenn auch knappe Monografie zu diesem Thema vorgelegt. Die Kürze ist dabei weniger dem Inhaltlichen als der Form der Buchserie Environmental Humanities geschuldet (höchstens 75 Seiten). Wie Leyda auch zu Beginn des Buches zugibt: "I have more to say on this than can fit into this short form […]", um zugleich hinzuzufügen: "[…] and there will be more to come." (S. 3) Und dennoch gibt es bereits in diesem Bändchen eine Fülle an Analysen verschiedener screen texts, die sich den Fragen widmen, wie Schwarze Filme und Fernsehserien die Klimakatastrophe adressieren und wie norwegische Serien die An- und Abwesenheiten von Öl und Race verhandeln (vgl. S. 1).
In den folgenden drei Kapiteln werden sodann rezente Filme und Serien in den Blick genommen, die auf ihr climate unconscious (vgl. S. 4) hin befragt werden. Das klimatisch Unbewusste beschreibt dabei jene "structures of feeling that characterize current film and television’s particular ways of processing environmental thinking" (S. 4) beziehungsweise "the ways environmental issues find expression aesthetically and affectively in clusters of media texts." (Ebd.) Diese Darstellungen müssen nicht unmittelbar auf die Klimakatastrophe bezogen sein, sondern können auch in Einzelheiten aufscheinen, wie zum Beispiel im Schweiß auf den Gesichtern der Darsteller*innen in The Walking Dead (2010-2022), die in der "post-air conditioning era" der starken Hitze der amerikanischen Südstaaten ausgesetzt sind, wie Leyda mit Verweis auf einen ihrer eigenen Aufsätze schreibt (vgl. Leyda 2021).
Über das klimatische Unbewusste hinaus schließt Leyda noch an den Begriff des Anthropozäns an, das als Konzept die Implikation der Klimakatastrophe stärker expliziert. Denn jegliche 'natürliche' Prozesse wie Erdbeben können jetzt – in diesem Zeitalter des 'Menschen' – als teilweise anthropogen beschrieben werden. Auch wenn das Konzept des Anthropozäns sowohl hier als auch im Titel prominent vorkommt, behält Leyda einen kritischen Abstand zu jenem unmarkierten Begriff des Menschen, gerade indem sie Diskurse um Race, sei es american Blackness oder norwegian Whiteness, aufgreift und problematisiert.
Im zweiten Abschnitt stellt Leyda zwei Black screen productions einander gegenüber: Die Serie Queen Sugar (2016-2022), die von den drei Geschwistern der Borderlon-Familie handelt, die eine Zuckerrohrplantage von ihrem verstorbenen Vater erben, sowie dem Superheldenfilm Black Panther (2018). Für ihre Analyse von Queen Sugar greift sie den äußerst fruchtbaren Begriff des banalen Anthropozäns auf, um zu beschreiben, dass auch die alltäglichen, ländlichen und (vermeintlich) friedlichen Umgebungen, wie die Zuckerrohrfelder in Queen Sugar, Teil des Anthropozäns und damit das Resultat von Kolonialismus, Extraktivismus und globaler Expansion sind. Der Begriff stammt von der Anthropologin Heather Anne Swanson, die damit den Anblick der Kornfelder in Iowa und die damit verbundene Unsichtbarkeit der vergangen und andauernde Gewalt, die diese Landschaften hervorgebracht haben, beschreibt (vgl. Swanson 2017). Auch wenn die ruinierten Landschaften in Iowa noch beinahe unschuldig anmuten können, so erscheinen die Felder der Black-owned farm als ständige Erinnerung "of how his [Ralph Angel Bordelon T.Z.] ancestors performed similar labor, albeit without farm machinery or the mantle of freedom, much less proprietorship." (S. 17) Dabei scheint sich Leydas Strategie des "reading the climate unconscious" (S. 4) weniger auf die oberflächige Handlung als vielmehr auf das "affective and aesthetic world-making" (S. 19) der Filme und Serien zu beziehen, das im "hum of the air conditioning and the traces of sweat" (S. 18) zu finden ist und Louisiana als "inhospitable climate both literally and figuratively" (S. 18) zeigt, was von Leyda fruchtbar mit Christina Sharpes Überlegungen zum "climate of anti-Blackness" (Sharpe 2016, S. 111) in Verbindung gebracht wird (S.19).
Auch ihre Analyse von Black Panther konzentriert sich mehr auf die Utopie (dt. den Nichtort, das Nirgendland), die das versteckte high tech und afrofuturistische Land Wakanda darstellt. Dabei betont sie, dass Wakanda eine andere Beziehung zu seinem wertvollen Rohstoff Vibranium hat, als es im extraktivistischen Kapitalismus der Fall ist. Denn es kann erstens diesen selber verwerten, ohne Opfer westlicher Kolonisation zu werden (vgl. S. 24f) und zweitens diesen nicht nur materiell (Waffen, Rüstungen, Transport, Energiequelle und Medizin) sondern auch spirituell in "providing access to the ancestors and consecrating their leaders as Black Panthers" (S. 24) nutzen. Dennoch wäre es spannend gewesen, wenn Leyda dieses "affective scenario" (S. 21) noch auf die Handlung des Films bezogen hätte, da es dort genau um die Frage geht, wie mit dieser Utopie umgegangen werden soll und ob die Technologien Wakandas mit anderen geteilt werden sollen.
Im dritten Kapitel untersucht Leyda zwei neuere cli-fi Produktionen, die sich von älteren Konventionen der "White cis-men [who] occupy lead roles as heroic fathers" abgrenzen: Den amerikanischen Film Fast Color (2018) und die norwegische Serie Ragnarok (2020-2023). In beiden Werken spielen Kinder von alleinerziehenden Müttern die Hauptrolle, die mit ihren fantastischen Fähigkeiten das Wetter willentlich verändern können. Fast Color zeigt für Leyda die "[…] racialized and gendered revision of cli-fi clichés, thematizing and portraying that which often goes unseen or unrepresented in contemporary speculative fiction: a young Black woman embodying environmentalist agency." (S. 36) Dabei stellt der Film sowohl das (Über)Leben in "anti-Black atmospheres" (S. 39) als auch die Schäden der Klimakatastrophe in der Form einer andauernden Dürre im "arid scrubland of what is currently the southwestern United States" (S. 37) dar.
Die norwegische Serie Ragnrarok erzählt eine ähnliche Geschichte: "[T]urbulent personal emotions catalyze the young person’s weather-controlling powers, which they employ in defense of the collective good." (S. 41) Dabei adaptiert Ragnarok Teile der nordischen Mythologie, um den Kampf zwischen den Asen und Jötunn zu zeigen, hier in Form der reichen Jutul Familie gegen eine Reihe von Schulkindern, die jeweils die Reinkarnationen verschiedener nordischer Götter sind. Das climate unconscious liegt hier laut Leyda in den Verwicklungen von norwegian Whiteness, der nordischen Mythologie sowie der norwegischen Natur, die zusammenlaufen im Kampf der Hauptfigur "against [the] ecocrime" (S. 46) der Jutul Familie. Dabei setzt die Serie die nordische Mythologie ein als "a national 'eco-exceptionalism' ([Mrozewicz] 2020:85) that both exposes and represses environmental crimes and mobilizes the teenaged avatar of Thor to save Norwegian nature." (S. 45) Dabei ist lobend hervorzuheben, dass die Serie (wie auch die zwei Serien in Kapitel 4) in Hinblick sowohl auf climate als auch Whiteness untersucht werden, was nicht selbstverständlich ist. Denn wie Leyda selbst zu Beginn des Buches schreibt: "[S]creen Whiteness is often not racialized enough, particularly outside Anglophone contexts." (S. 9)
Im vierten Kapitel behandelt Leyda zwei Serien, State of Happiness (2018-2024) und Occupied (2015-2019), die eine bis dahin narrative Leerstelle im norwegischen Film- und Serienschaffen füllen: Öl. Mit Verweis auf Kari Norgaard spricht Leyda von "'normalizing narratives' that help Norwegians maintain a positive national identity (Norgaard 2011:11)." (S. 52) Das affective reading konzentriert sich dabei auf petroguilt, obwohl beide Serien mit sehr unterschiedlichen Affektregistern arbeiten: "[A]n ambience of cozy familiarity and nostalgia suffuses State’s national mythmaking around the origin story of Norway’s oil encounter, while a prevailing sense of dread and suspense drives Occupied’s near-future, far-fetched parable about a Russian occupation of Norway’s oil industry. However, reading them together for the operation of the climate unconscious reveals the same affective engine powering both series: petroguilt and its intimate imbrications in Norwegian pasts." Während State of Happiness einen Mythos um die (Weiße) norwegische Nationalidentität kreiert, der mit einer Generationsunschuld der 1960er (S. 59) daher kommt, zeigt Occupied das tatsächliche und wachsende Gefühl einer Angst vor der Zukunft, in der die Klimakatastrophe jegliche Teile des Alltagslebens bedroht und in der Norwegens gewinnbringende Ölindustrie durch die Umstellung auf fossilfreie Energiegewinnung gefährdet wird (vgl. S. 62). Dabei liest Leyda die Hauptfigur Bente Norum aus Occupied allegorisch als Verkörperung der petroguilt. In ihrem apolitischen Egoismus lässt Bente sich mit den russischen Besetzern ein, die laut Leyda eine Allegorie auf das Öl sein sollen, und setzt ihr eigenes "well-being over any noble devotion to the environment, or the nation and its sovereignty." (S. 64)
Die Stärke von Leydas Analysen und Deutungen liegt darin, die unterschwelligen Stimmungen und Gefühle der Werke herauszuarbeiten und diese im Rahmen der Klimakatastrophe und Fragen von Blackness und Whiteness zu betrachten. Dabei ist vor allem die Auswahl der Beispiele anregend, da es sich um Werke handelt, die bislang kaum besprochen wurden. Dennoch wünscht man sich – vor allem bei den Serieninterpretationen –, dass diese ausführlicher ausfallen und noch mehr auf die Entfaltung der Geschichte und Affektverläufe eingehen würden. Dementsprechend wünschenswert bleibt die von Leyda in Aussicht gestellte Fortführung dieser Gedanken, sodass ein womöglich umfangreicheres Buch zu diesem Thema, seinen Gegenständen den verdienten Raum schenken kann.
Literatur:
Leikam, Susanne/Leyda, Julia: "Cli-fi in American studies: A research bibliography". American Studies Journal 62, 2017. www.asjournal.org/62-2017/cli-fi-american-studies-research-bibliography/ (abgerufen am: 29.04.2025).
Leyda, Julia: "Post-air-conditioning futures and the climate unconscious". In: Screen 62/1, 2021, S. 100–106. https://doi.org/10.1093/screen/hjab009.
Mrozewicz, Anna Estera: "The landscapes of eco-noir: Reimagining Norwegian eco-exceptionalism in Occupied". In: Nordicom Review 41/Special Issue 1, September 2020, S. 85-105. https://doi.org/10.2478/nor-2020-0018.
Norgaard, Kari Marie: Living in Denial: Climate Change, Emotions, and Everyday Life. Cambridge, MA: MIT Press 2011. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262015448.001.0001.
Sharpe, Christina: In the Wake: On Blackness and Being. Durham, NC: Duke University Press 2016. https://doi.org/10.1215/9780822373452.
Svoboda, Michael: "Cli-fi on the screen(s): patterns in the representations of climate change in fictional films". In: WIREs Climate Change 7/1, Dezember 2015, S. 43-64. https://doi.org/10.1002/wcc.381.
Swanson, Heather Anne: "The banality of the Anthropocene." In: Society for Cultural Anthropology, February 22 2017. https://culanth.org/fieldsights/the-banality-of-the-anthropocene (abgerufen am: 29.04.2025).
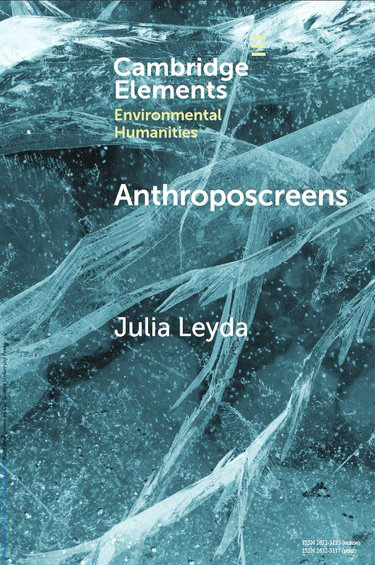
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2025 Timo Zohren

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



