Denise Labahn: Queere Fanfictions – Queere Utopien? Hetero- und Homonormativität in Fanfictions zu US-Vampir-Serien.
Bielefeld: Transcript 2023. ISBN: 978-3-8376-6919-0. 216 Seiten, 49,00 €.
DOI:
https://doi.org/10.25365/rezens-2025-1-14Abstract
Der/die Vampir*in als Gegenbild zu gesellschaftlichen Normvorstellungen ist die Prämisse für Denise Labahns Dissertation Queere Fanfictions – Queere Utopien? Hetero- und Homonormativität in Fanfictions zu US-Vampir-Serien. Die Vampir*innen findet sie in US-amerikanischen Serien der 1990er/2000er Jahre und sie interessiert sich dabei besonders für deren Rezeption. Labahn verortet ihre Arbeit im Forschungsfeld um Fanfiction und rollt dieses aus zwei Perspektiven auf – mit Blick auf Fanfictiontexte und im Austausch mit Fanfiction Schreibenden und Lesenden.
"Die Möglichkeit zum prozesshaften, offenen und auch kollektiven Schreiben, als eine Besonderheit von Fanfictions" (S. 13) ist das, was Labahn (die sich selbst als Fan "outet") ihrer Hypothese voranstellt. Sie fragt nach dem utopischen Potential von Fanfictions und untersucht spezifisch den Kontext queerer Fanfictions. "[E]benso wie Vampir*innen auf umfassendere gesellschaftliche Problemlagen verweisen, kann dies auch für Utopien festgestellt werden" (S. 64), konstatiert Labahn und legt mit dieser konzeptuellen Nähe den Grundstein für ihr Forschungsvorhaben.
Sie unterteilt ihre Arbeit in zwei Gegenstandsfelder – zum einen wählt sie verschiedene deutschsprachige Fanfictions aus, die zu Vampirserien auf der Online-Plattform fanfiktion.de verfasst wurden. Hier konzentriert sie sich auf Texte zu den US-amerikanischen Serien Buffy – Im Bann der Dämonen (US 1997-2003), True Blood (US 2008-2014) und Vampire Diaries (US 2009-2017). Zum anderen verwendet Labahn eine von ihr angeleitete Online-Gruppendiskussion mit 57 Fanfiction Schreibenden und Lesenden, die sich durch eine Ausschreibung vorab selbst als queer identifiziert haben.
Für die Teilnehmer*innen der Diskussion verwendet Labahn den Begriff der Produser*innen, geprägt von Axel Bruns. Die Unterscheidung zwischen Erschaffen und Rezipieren von Fanfictiontexten wird hier weitestgehend aufgelöst. Bruns verbindet dies in seiner Theorie mit einer Gegenwirkung zu industriellen Wertschöpfungsketten (vgl. S. 108). Im Begriff des Produsage bündelt Labahn so disruptives Potential im Hinblick auf Utopien im Kontext von queeren Fanfictions.
Die Fanfictiontexte und die Online-Gruppendiskussion unterzieht Labahn einem Analyseverfahren, das sie als "queere Inhaltsanalyse" betitelt (in Anlehnung an Udo Kuckarzts und Philipp Mayrings qualitative Inhaltsanalyse, sowie den Ansatz des Queer Readings nach Eve Kosofsky Sedgwick und weiteren (vgl. S. 160)). So möchte Labahn "queer[e] Potenziale auch solcher Texte heraus[arbeiten], die nicht explizit queere Themen behandeln, sondern, bei denen sich queeres Begehren unter der Oberfläche ansiedelt" (S. 163). Dieses Spannungsfeld macht Labahn für ihre Analyse in den Fanfictions der Vampirserien aus.
Mit einer ausführlichen Einordnung der Figur der Vampirin bzw. des Vampirs im filmgeschichtlichen Kontext wird mit Magrit Dorn die Funktion der Vampir*in als Maß gesellschaftlicher Machtverhältnisse und Krisen nachgezeichnet (vgl. S. 53ff). Vampir*innen bilden insofern den Ausgangspunkt von Labahns Forschungsvorhaben, als dass ihnen von Grund auf etwas Grenzüberschreitendes, mit Normen Brechendes, Queeres innewohnt (vgl. S. 62f). Sie untersucht queeres Potential in der Ambiguität von Alter, Sexualität und Verwandtschaft der Vampir*innen-Figuren. Offen bleibt an dieser Stelle eine Positionierung von Labahn zu Vampir*innen-Figuren, die trotz ihrer fantastischen Konstruktion tradierte, patriarchale Narrative dezidiert verstärken und romantisieren; in Twilight (US 2008) beispielsweise genauso wie in den drei ausgewählten Serien. Da Labahn in der Reflexion ihrer Arbeit problematisiert, dass Teile des von ihr ausgewählten Fanfiction-Korpus patriarchale und heteronormative Strukturen ungefiltert reproduzieren (vgl. S. 255), fragt sich, inwiefern mit dem Analysefokus auf queere Utopien dieser Schwerpunkt bereits bei der Auswahl des Materials gewinnbringender hätte gesetzt werden können.
Labahn versteht Utopie in ihrer Arbeit als Normabweichung und zeichnet den Utopie-Begriff in Abgrenzung zu statischen Zukunftsbildern, wie sie in zukünftigen Gesellschaftsmodellen nach der Tradition von Thomas Morus ("Utopia", 1516) formuliert werden, nach. Das Experimentieren, Erproben und Austesten von Abweichungen zu patriarchalen oder heteronormativen Normen setzt Labahn als Ausgangspunkt ihrer Frage nach queeren Utopien und bezieht sich auf den Ansatz der "prozessualen Utopie" von Erin McKenna (vgl. 72ff). Hier geht es als pragmatistischer Ansatz also nicht um ein spezifisches, utopisches Ziel, sondern um das gemeinschaftliche Denken und Handeln, das den Weg zu einem solchen Ziel überhaupt erst ebnet. Ergänzend nimmt Labahn María do Mar Castro Varelas Forschung zu Heterotopien auf und spricht von gelebten Utopien (vgl. 78f). Darunter fasst Labahn eine Veränderung von individuellen Selbstverständnissen, sozialen Gefügen oder gesellschaftspolitischen Perspektiven und bezieht sich für ihre Frage nach queeren Utopien damit konkret auf den Vorgang des Produsage von Fanfictions.
Der erste Analyseschwerpunkt liegt auf dem Gegenstandsfeld der Fanfictiontexte. In der Auswertung der ausgewählten Texte identifiziert Labahn drei Themenkomplexe: Familie und Verwandtschaft, Liebe und Verbundenheit, und Geschlecht und Sexualität. Sie arbeitet heraus, inwiefern die Vampir*innen-Figuren in den Fanfictiontexten eine Projektionsfläche für Grenzüberschreitungen bieten und tradierte Konstruktionen von (Kern)Familie und Reproduktion hinterfragt werden (vgl. S. 227ff). Im Sinne einer "VerUneindeutigung" nach Antke Engel (vgl. S. 21) identifiziert Labahn die Ambiguitäten der Vampir*innen-Figuren als Destabilisierungsprozesse von Heteronormativitäten.
Die Auswertung der Online-Diskussion stellt den zweiten Analyseschwerpunkt dar und bietet im Vergleich zur inhaltlichen Analyse der Fanfictiontexte eine tiefgreifendere Argumentation. "Insofern das Verändern, Modifizieren und Anpassen des Originaltextes als Widerstand gegen hegemoniale Bedeutungsproduktionen gewertet wird, lassen sich im Schreiben von Fanfictions queere Potenziale herausarbeiten" (S. 119), stellt Labahn voraus. Aspekte von Community und Zusammenarbeit zeigen sich in der Auswertung der Online-Diskussion als grundlegend (vgl. S. 298ff). Den digitalen Raum von Fanfiction-Websites markiert Labahn als Ort queerer Agency, da er als Schutzraum für persönliche und intime Erzählungen und Austausch dient (vgl. S. 340).
Fanfiction als digitales Medium versteht Labahn als Praxis queerer Utopie (vgl. S. 19), zum einen durch ihre Zugänglichkeit und geteilte Community, zum anderen im Umdeuten oder Gegen-den-Strich-Lesen existierender Narrative. Besonders die Zugänglichkeit des Fanfiction Schreibens ist jedoch kritisch zu befragen, so stellt Labahn heraus, dass die Mehrheit der Produser*innen (sowohl in der von ihr befragten Gruppe als auch in weiteren Erhebungen) weiße Frauen sind, die vor allem genug Zeit zur Verfügung haben, diese in Fanfiction zu investieren (vgl. 205ff). Labahn bietet zum Ende ihrer Arbeit den Ausblick, das Feld (queerer) Fanfiction weiterführend auf dessen intersektionale und transnationale Beschaffenheit zu befragen. Besonders mit Blick auf das utopische Potential von Fanfictions erscheint diese Ergänzung als sinnvoll und hätte mitunter tiefgreifender auch in Labahns Analyse integriert werden können.
In Bezug auf die Fanfiction-Community weist Labahn auf verschiedene Feedbackstrukturen und Formen der Zusammenarbeit hin, die Fanfictiontexte und Produsage als Projekte des Austauschs und als gemeinsame Aushandlungsprozesse kennzeichnen, beispielsweise sogenannte "Partner*innen-Fics" (vgl. S. 320ff). Auf der Basis dieser kollaborativen und ergebnisoffenen Interaktionen ordnet Labahn die Praxis des Produsage als "prozessuale Utopie" ein. Schlussfolgernd sieht sie die Verflechtung aus intendierter Unabgeschlossenheit und communitybasiertem Austausch als Experimente der Produser*innen, die mit Labahns Verständnis von Utopie als Modus des Austestens von und Experimentieren mit Normabweichungen zusammenpasst.
Die ausgewählten Fanfictiontexte über Vampir*innen als Grenzüberschreiter*innen im Spannungsfeld heteronormativer Liebeserzählungen und die Online-Diskussion mit queeren Produser*innen schlagen den Bogen zu den von Labahn spezifisch als queer untersuchten Utopien. Die Analyse der Vampir*innen-Figuren in den Fanfictions der ausgewählten Serien unterscheidet sich in ihrem Fazit der Grenzüberschreitungen nicht maßgeblich von Charakteristika subversiver oder queerer Vampir*innen in weniger prominenten Serien, wie First Kill (US 2022) und Interview with the Vampire (US 2022) oder Filmen, wie The Hunger (UK 1983) und Only Lovers Left Alive (UK 2013). Auch wenn die Arbeit zu Vampirserien keine gänzlich neuen Perspektiven eröffnet, liefert Labahn eine aufschlussreiche Untersuchung von queeren Positionen im Produsage von Fanfictions und trägt dazu bei, diesen Fokus im Feld der Fanforschung zu schärfen.
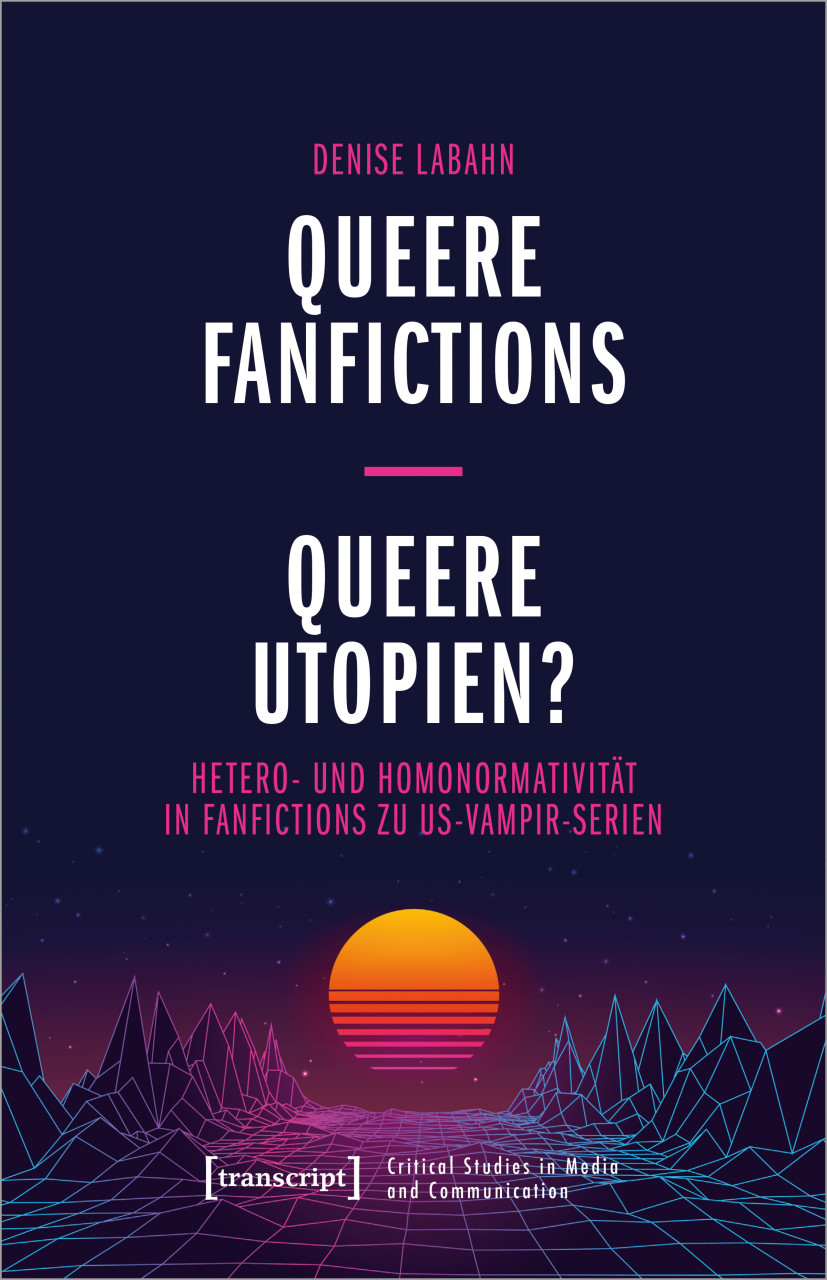
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2025 Anna Sacher

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



