Denis Newiak: Die Einsamkeiten der Moderne. Eine Theorie der Modernisierung als Zeitalter der Vereinsamung. \\\\ Denis Newiak: Einsamkeit in Serie. Televisuelle Ausdrucksformen moderner Vereinsamung.
Wiesbaden: Springer 2022. ISBN: 978-3-658-35810-5. 250 Seiten, 59,99 € \\\\ Wiesbaden: Springer 2022. ISBN: 978-3-658-35808-2. 335 Seiten, 69,99 €
DOI:
https://doi.org/10.25365/rezens-2025-1-10Abstract
In einer zunehmend digitalisierten Welt, in der soziale Bindungen durch Plattformlogiken, mobile Interfaces und algorithmische Kommunikation geprägt sind, wird Einsamkeit zur unterschwelligen Grundmelodie des Alltags. Als eine der einflussreichsten medialen Ausdrucksformen unserer Gegenwart, greifen Serien dieses Gefühl auf – nicht nur als Thema, sondern auch als ästhetische Struktur. Sie erzählen von isolierten Figuren, zersplitterten Beziehungen und scheiternden Gemeinschaften. Mit den beiden komplementären Monografien Die Einsamkeiten der Moderne und Einsamkeit in Serie legt Denis Newiak ein kohärentes Theorie- und Analyseprojekt vor, das sich interdisziplinär mit dem Phänomen der Einsamkeit auseinandersetzt. Beide Werke beruhen auf Newiaks Dissertation "Televisuelle Ausdrucksformen moderner Einsamkeit. Diskurse und Analysen", die als zwei eigenständige Bände publiziert wurden. Während Die Einsamkeiten der Moderne eine soziologisch und kulturtheoretisch fundierte Theorie der Einsamkeit als Strukturmerkmal der Moderne entwirft, widmet sich Einsamkeit in Serie der konkreten Repräsentation dieses Gefühls in zeitgenössischen Fernsehserien. Gerade im Zusammenspiel beider Werke zeigt sich, wie theoretische Reflexion und medienanalytische Schärfe ineinandergreifen, um das serielle Erzählen als privilegierten Ort der Darstellung, Erfahrung und Reflexion moderner Einsamkeit zu erschließen.
In Die Einsamkeiten der Moderne arbeitet der Autor dem "Beschreibungsdefizit" (S. XV) der Einsamkeit(en) entgegen, welches er neben der "Untertheoretisierung" (S. XIII) als Desiderat der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Zeitalter der Moderne identifiziert. Newiak entwickelt zunächst ein mehrdimensionales Verständnis von Einsamkeit, das nicht als individuelles Defizit, sondern als systemische Begleiterscheinung moderner Vergesellschaftung interpretiert wird. "Die Moderne kommt mit erstrebenswerten Verheißungen, die sie attraktiv werden lassen, doch es gibt sie nicht kostenlos. Ihr Preis sind die modernen Einsamkeiten" (S. XI) konstatiert der Autor und benennt somit Einsamkeit zum Kernmerkmal der Moderne. Wohlstand, Sicherheit und Freiheit der Moderne sind demnach nur auf Kosten von Gemeinschaft erreichbar (vgl. S. V). Anhand historischer Entwicklungslinien wie der Säkularisierung (Kap. 2), der Urbanisierung (Kap. 3), der Industrialisierung (Kap. 4) und der Digitalisierung (Kap. 6) zeigt er, wie sich durch den Verlust traditioneller Gemeinschaften, Individualisierung und soziale wie digitale Fragmentierung unterschiedliche Formen von Einsamkeit – soziale, emotionale, psychologische, mediale – von der Vormoderne bis hin zur Netzwerkgesellschaft manifestieren. Dabei versteht Newiak Medien im Kontext moderner Einsamkeit als ambivalente Kräfte: Einerseits verstärken sie durch digitale Vernetzung, algorithmische Kommunikation und simulierte Nähe neue Formen der sozialen Isolation (vgl. Kap. 6). Andererseits bieten sie, insbesondere durch Kunstformen wie Film, Fernsehen und Fotografie, symbolische Räume, in denen Einsamkeit erfahrbar, reflektierbar und kollektiv verhandelbar wird (vgl. S. VI).
Newiak schließt seine umfassende historische wie theoretische Aufarbeitung mit der Erkenntnis, dass die Moderne ein irreversibler Prozess ist, der geprägt ist von stetigem Wandel, Fortschritt und der Abgrenzung vom Vormodernen. Eine Rückkehr zu früheren Gemeinschaftsformen erscheint weder realistisch noch wünschenswert, da sie mit dem Verlust moderner Errungenschaften einherginge. Stattdessen fordert das Werk einen reflektierteren Umgang mit den vielfältigen Einsamkeiten, die die Moderne hervorgebracht hat – gerade auch im Hinblick auf eine ungewisse Nachmoderne, die neue Herausforderungen bereithalten könnte (vgl. S. 231). Der Autor stützt seine Analyse auf eine breite Auswahl einschlägiger Fachliteratur und Fachvertreter*innen und tritt in einen produktiven Dialog mit zentralen theoretischen Positionen, um den Begriff der Einsamkeit neu zu konturieren. Am Ende steht eine vielschichtige Re-Theoretisierung der Moderne als einer Epoche, in der Einsamkeit nicht nur Ausdruck individueller Befindlichkeit, sondern auch Symptom gesellschaftlicher Grundbedingungen ist. Besonders einprägsam ist sein Vorschlag, von "Einsamkeiten" im Plural zu sprechen, um deren Vielgestaltigkeit und Kontextabhängigkeit zu betonen (S. XX).
In Einsamkeit in Serie greift Newiak diese theoretischen Überlegungen auf und überträgt sie auf die Analyse ausgewählter US-amerikanischer Serienformate. Fernsehserien werden hierbei als prädestinierte Ausdrucksformen von Einsamkeiten gelesen, da sie Vereinsamungstendenzen der Spätmoderne aufgreifen und diese durch visuelle Ästhetik (Kap. 1), narrative Strukturen (Kap. 2), Figurenkonstellationen (Kap. 3), Inszenierungsformen (Kap. 4) und Klangwelten (Kap. 5) darstellen und verhandeln (vgl. S. XVII). Exemplarisch skizziert der Autor diese Funktionsweise an den Drama-Serien 13 Reasons Why (2017-2020) und Bates Motel (2013-2017) sowie der Sitcom The Big Bang Theory (2007-2019). Serien agieren als ästhetische Aushandlungsräume moderner Einsamkeiten, sie "kommen genau dann zum Ende, wenn die Vereinsamung oder die Vergemeinschaftung der Hauptfiguren abgeschlossen ist" (S. 269). Damit fungieren Serien Newiak zufolge nicht nur als Ausdrucksformen gesellschaftlicher Entwicklungen, sondern als kulturelle Verfahren zur Bearbeitung und Deutung spätmoderner Entfremdungserfahrungen. Durch die gezielte Inszenierung von Isolation, sozialen Bruchstellen und vergemeinschaftenden Momenten verdichten Serien komplexe soziale Phänomene zu narrativen und audiovisuellen Erfahrungsräumen. Insbesondere durch ihre multimedialen Ausdrucksschichten, von der Bildkomposition bis zur Klangdramaturgie, ermöglichen sie eine sinnlich-affektive Reflexion über zentrale Krisenerfahrungen der Gegenwart.
Inhaltlich überzeugt das Werk durch seine strukturierte Analyse von fünf ästhetischen Schichten des Fernsehens, in denen sich moderne Einsamkeit artikuliert: visuell durch Un-Orte (Kap. 1.1. – motel, suburb, home) und symbolisch aufgeladene Requisiten (Kap. 1.4), narrativ durch Geschichten sozialer Überforderung (Kap. 2.3), figürlich durch Typen wie den überangepassten Nerd (Kap. 3.1) oder das traumatisierte Jugendlichensubjekt (Kap. 3.3), dramaturgisch durch das Spannungsfeld von Vergemeinschaftung (Kap. 4.1 – Komödie/ Sitcom) und Vereinsamung (Kap. 4.2 – Tragödie) sowie klanglich durch melancholische oder verstörende Soundscapes (Kap. 5). Newiak verdeutlicht, dass Serien Einsamkeit nicht nur darstellen, sondern diese durch ihre ästhetische Konfiguration auch reflektieren, intensivieren und kontextualisieren. Er verbindet Einsamkeit und gesellschaftliche Strukturen und zeigt damit eindrücklich, wie Serienfiguren als Symptom spätmoderner Vereinsamung lesbar werden: In 13 Reasons Why wird Hannah Baker als Opfer digitaler Überforderung und einer hyperindividualisierten Leistungskultur gezeigt. Ihre Tonbänder sind ein letzter Versuch, in einer emotional abgekoppelten Welt Gehör zu finden (vgl. Kap. 2.3). Bates Motel inszeniert das Motel als Un-Ort spätmoderner Isolation. Normans psychischer Zerfall spiegelt sich symbolisch im immer wieder auftauchenden Duschvorhang (vgl. Kap. 1.4). In The Big Bang Theory verkörpert Sheldon Cooper die soziale Dysfunktion des modernen Nerds, dessen intellektuelle Stärke echte Nähe verhindert (vgl. Kap. 3.1).
Besonders gelungen ist dabei die Verbindung kulturwissenschaftlicher Theorie mit medienanalytischer Praxis. Seine zentrale These, dass Fernsehserien durch ihre komplexe Ästhetik nicht nur Repräsentationen, sondern auch produktive Aushandlungsräume moderner Einsamkeit darstellen, wird durch die Fallanalysen schlüssig gestützt. Newiaks interdisziplinärer Ansatz eröffnet dabei neue Perspektiven auf das Verhältnis von Populärkultur, Medien und gesellschaftlicher Erfahrung in der Spätmoderne.
In seiner Analyse der Moderne gelingt es Newiak eindrucksvoll, die doppelte Natur gesellschaftlicher Krisen offenzulegen. Anhand zahlreicher theoretischer Linien und aktueller Beispiele zeigt er, dass Krisen keineswegs nur destruktive Zäsuren darstellen, sondern vielmehr als produktive Kraftquellen wirken können. Sie destabilisieren gewohnte soziale Ordnungen und verstärken die Vereinzelung, doch gerade dadurch machen sie die oft verborgene Struktur moderner Einsamkeit sichtbar. Newiak argumentiert überzeugend, dass Krisen Reflexionsräume eröffnen: Sie zwingen zum Innehalten, zur Selbstbeobachtung und zur kritischen Auseinandersetzung mit Fragen nach Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Sinn. Damit erscheinen sie als Auslöser gesellschaftlicher Selbstverständigungsprozesse – als Antrieb für Erkenntnisgewinn und soziale Neuorientierung. In dieser Perspektive wird die Krise selbst zum Brennglas für die vielgestaltigen, sonst oft unsichtbaren Einsamkeiten der Moderne.
Bemerkenswert ist auch die systematische Vorgehensweise und Bewertung von Einsamkeitsmotiven serieller Narrationen. Newiak entwickelt ein eigenes Analyseraster, das sowohl visuelle als auch narrative Parameter berücksichtigt. Damit bietet Einsamkeit in Serie inhaltlich wie methodisch einen Mehrwert für medienwissenschaftliche Arbeiten zur Fernsehserienanalyse.
Mit Die Einsamkeiten der Moderne und Einsamkeit in Serie legt Denis Newiak ein doppeltes Grundlagenwerk zur Analyse moderner Vereinsamung vor, welches theoretisch fundiert und medienanalytisch präzise ist. Der Autor leistet damit einen substanziellen Beitrag zur aktuellen Medien- und Kulturforschung und stellt zugleich ein vielseitig einsetzbares Instrumentarium zur Verfügung, das die Analyse von Fernsehserien im Kontext gesellschaftlicher Erfahrungen ermöglicht. Besonders hervorzuheben ist die produktive Verzahnung von Theorie und Praxis, die eine ebenso reflektierte wie anwendungsorientierte Auseinandersetzung mit dem Thema erlaubt.
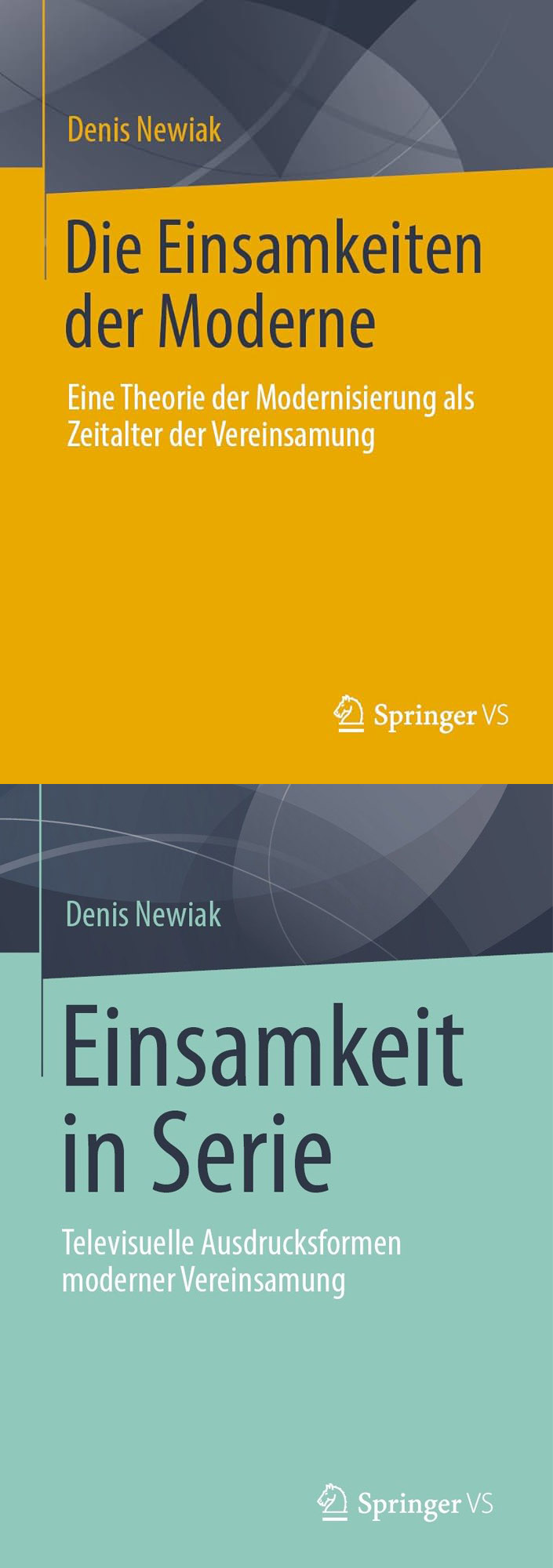
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2025 Kim Carina Hebben

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



