Ludger Schwarte (Hg.): Bild-Performanz. Die Kraft des Visuellen.
München: Fink 2011. ISBN 978-3-7705-5079-1. 392 S. Preis: € 49,90.
Abstract
Vielversprechend klingt der Titel der neuen Publikation der Bildtheorie-Schmiede eikones. Auch die optische Hülle des von Ludger Schwarte herausgegebenen Bandes Bild-Performanz besticht im für die NFS-Bildkritik mittlerweile etablierten Design des Fink-Verlags: Vom Cover fixiert uns der kühle Blick des Verschwörers Lewis Payne, der einst Roland Barthes dazu veranlasste, seine Studien zum 'punctum' auszuführen. So markiert allein schon die Außenansicht des Buchs den Eingang zum Kaninchenbau einer Bildtheorie, die – wie man es aus Basel erwartet – historischen Bezug mit Aktualität vereint. Die Inhaltsangaben verraten eine nach logischen Parametern geordnete Zusammenstellung der einzelnen Beiträge, die mit grundlegenden Definitionsfragen zu Bild und Performanz beginnen und sich über philosophische Problematiken hin zu angewandten Analysen verschiedener medialer Zusammenhänge (Film, Fotografie, bildende Kunst bis hin zu Literatur) entwickeln.
In der vom Herausgeber verfassten Einleitung vermittelt ein Lobgesang auf die Bilder eindringlich, dass den Damen und Herren in Basel ihre Berufung, Bilder zu analysieren und zu theoretisieren wirklich Freude bereitet. Sätze wie "Bilder sind die Münzen der globalen Kommunikation." (S. 12) geben dann aber schon zu denken: zum Beispiel inwiefern es sich bei globaler Kommunikation um eine Währung handelt, wie die Metapher für das Papiergeld im Vergleich zu den Münzen zu denken wäre und was damit überhaupt bezahlt werden soll. Abgesehen davon verspricht der einführende Streifzug durch die verschiedenen Texte der Publikation kontroversielle Auseinandersetzung im Spannungsfeld von bildlichen und performativen Darstellungsstrategien.
Direkt daran anschließend stellt Emmanuel Alloa in seinem Beitrag die Widersprüche zwischen Performanz und Bild fest, nur um diese angenommene Gegensätzlichkeit im Folgenden schrittweise auszuhebeln und eher die Gemeinsamkeiten hervorzuheben. Dazu entwirft er zunächst ein neues Konzept von Herstellung als Darstellung: Die performative Produktion ist nicht nur ein Hervorbringen, sondern auch ein Vorführen. So wie die Performances den Blick auf das Vollziehen des Aktes darstellen, weisen Bilder darauf hin, wie sie etwas zeigen. Bild und Performanz treffen sich demnach in ihrer Selbstbezüglichkeit. Zudem sei der Prozess des Sichtbarmachens, der die Bildlichkeit auszeichnet, selbst als performativ zu erachten. Hier ergeben sich weitere spannungsreiche Koppelungen zwischen Bild und Performanz auf struktureller Ebene, auf der Alloa die bildliche Losgelöstheit vom Faktischen ausmacht: Bilder erproben das Mögliche, sie beschränken sich nicht auf die bloße Präsenz in der Gegenwart, sondern schaffen Verweise und Verbindungen – sie sind mehr konjunktiv als affirmativ. Entsprechend kommt Alloa zu dem Schluss, sowohl jede Performativität als Performanz des Erscheinens und umgekehrt auch jedes bildliche Erscheinen als performatives Ereignis zu bezeichnen. Und so sei am Ende die Phänomenalität unabhängig von der Performativität gar nicht zu beschreiben.
Mit derselben Grundfrage schon im Titel ("Gibt es eine Performanz des Bildlichen?") begibt sich Sybille Krämer wiederum auf ganz andere Wege. Nach einer Beschreibung der immanenten Wirklichkeitsmacht der Bilder (auch jenseits ihrer ästhetischen Erfahrung) analysiert sie diese Bildmacht hinsichtlich des Performativen. Ausgehend von einem Verständnis der "Performance als Ohnmachtserfahrung der Wirklichkeit" siedelt sie eine Analogie zwischen Bild und Performanz auf der Ebene der Rezeption an. So gelangt sie vom Bildakt zum Blickakt, der sich in einer "Trias von Modalitäten des Sehens" (etwas sehen – etwas als etwas sehen – etwas in etwas sehen) erschließt. Performativ wird das Blicken im Akt der Ermächtigung dessen, was erblickt wird. Derart bewaffnet unternimmt Krämer einen Streifzug durch verschiedene Bildtheorien (Klaus Krüger, David Freedberg, Georges Didi-Huberman), um diese nach der Frage der Blickbeziehung zwischen Bild und Betrachter zu durchforsten. Dabei werden die Dimensionen der Performativität schrittweise rekonstruiert. Folglich erschafft der Blick die Bilder, die daraufhin animierend rückwirken und eine Kraft entwickeln, durch die die Bildbetrachtung in ein Betroffensein umschlägt. Mit dieser weltkonstituierenden Wirkung stehen die Bilder mitten im Leben und ihre ästhetische Qualität tritt dadurch in den Hintergrund. Da es jedoch "keineswegs sinnvoll oder überhaupt nur möglich [sei], alle unsere 'Bildgebräuche' über den Leisten der hier als Blickverhältnis entwickelten pathischen Dimension zu scheren" (S. 83), postuliert Krämer identifizierendes oder reflektives Sehen im Gegensatz zum pathischen oder ästhetischen Sehen als Enden einer "Skala, auf der die Füllen unserer Bildpraktiken in beliebig komplexen Mischverhältnissen lokalisierbar sind" (ebd.).
Im Kommentar zu Krämers Beitrag versucht Emil Angehrn die Frage nach dem Bildakt einer kritischen Revision zu unterziehen und schreibt dem Bild drei zentrale performative Kräfte zu: die Erschaffung von Wirklichkeit, die Produktion von Sichtbarkeit und die kulturtechnische Praxis. Als fundamentale Grundlage der leistenden Kraft des Bildes erachtet Angehrn jedoch die bildliche Fähigkeit zur Erzeugung von Sinn: "Verstehen vollzieht sich […] in Konfrontation mit den Grenzen des Verstehens. Sinn versteht sich nicht von selbst, sondern ist immer in Frage gestellt" (S. 105). Und Sinnverhältnisse bestimmen schließlich auch die Welt, weswegen hier Bilder nur als Teil eines Medienkonglomerats gesehen werden, das die Welt verstehbar mache, wobei eine "autonome Macht und Konstruktivität der Performanz" (S. 107) ihrerseits in Frage gestellt werden müsse. Scheinbar um diesen Standpunkt zu untermauern bleiben die den Text illustrierenden Bilder weitgehend unkommentiert.
In die philosophisch sehr fundiert dargestellte Welt der Logik führt Dieter Mersch mit seinem Beitrag zur "Theorie des Bildlichen nach Wittgenstein". In seiner Analyse der doppelten Duplizität der Ikonizität bricht er die zweischneidige Lanze für eine Analyse des Bildes, die sich am Detail abarbeitet, ohne dabei die mediale Begrenzung (d. i. das Sein des Bildes) außer Acht zu lassen.
Aufschlussreiche "Überlegungen zur visuellen Performanz" im Zusammenhang einer Zeugenschaft der Bilder legt der Text des Herausgebers Ludger Schwarte vor. Ausgehend von Zeichnungen und Fotos, die über die Verbrechen in den NS-Konzentrationslagern Aufschluss geben, fragt Schwarte nach dem Unterschied zwischen schriftlicher/mündlicher Aussage und Bild. Ins Zentrum rückt dabei die spezifische Wahrheitsfähigkeit von Bildern, die jenseits des Aussage-Registers oder der Repräsentation agiert und die bis jetzt zugunsten der Diskussion über Manipulation, Illusion und Simulation in der Bildtheorie vernachlässigt worden sei. Die Relevanz von Bildern als Zeugen, die sich gegen ihre Autoren richten, indem sie "jenseits von Referenz und Symbolisierung" (S. 140) über ihre Entstehungsbedingungen informieren, zeigt Schwarte anhand der Fälle von medizinischen Experimenten im KZ Dachau. Die Bilder eines Filmstreifens des KZ-Arztes Sigmund Rascher (Exhibit 41) dienten im Nürnberger Ärzteprozess als Beweismittel gegen ihren Erzeuger, entstanden sie doch als Teil des "wissenschaftlichen" Experiments. Anders als Fingerabdrücke (oder andere Spuren des Tathergangs) sticht an diesen Bildern die Absicht hervor, mit der sie hergestellt wurden: Sie fixieren "eine materielle Konfiguration stichprobenartig" (S. 141), um an einem anderen Ort Evidenz zu erzeugen.
Daher wird im Exhibit 41-Exempel deutlich, "dass Bild gebende Verfahren in der Wissenschaft nicht unschuldig sind" (ebd.) und dass diese Wirkmacht von Bildern nach einer Epistemologie verlangt, die die Frage nach ihrer Evidenz neu aufrollt. Diese Hypothese unterstreicht Schwarte mit dem analysierenden Vergleich der zu wissenschaftlichen Zwecken hergestellten Bilder des Exhibit-Streifens mit Fotografien von Lagerhäftlingen und Zeichnungen des Überlebenden David Olère. Trotz der visuellen Aussagekraft dieser Bilder bleibe ihr Nutzen als Beweismittel jedoch beschränkt, da ihnen "die zwingende Kraft einer zur Aufklärung der verbrecherischen Tat führenden Schlussfolgerung, eine erklärende Verkettung von Ursache und Wirkung" (S. 146) fehle. Schwarte zufolge bestehe eine – wenn nicht die – zentrale Eigenschaft des Zeugnisses darin, dass es nicht durch Außenstehende überprüft werden kann: "Nur dann ist man auf einen Zeugen angewiesen, wenn man nicht wissen kann, sondern glauben muss" (S. 149). So gesehen verbirgt sich hier eine entscheidende Parallele zum technisch aufgezeichneten Bild, das wie der Zeuge oder die Zeugin kein "Ich beweise dir" ausspreche, sondern nur ein "Ich versichere dir, dagewesen zu sein" (S. 149).
Um die Bilder nicht als bloße Beweismittel zu instrumentalisieren, sondern ihnen vielmehr als Zeugen Aufmerksamkeit zu schenken, gelte es eine Sensibilität demjenigen gegenüber zu entwickeln, was die Bilder nicht direkt zeigen, sondern indirekt erfahrbar machen. Dazu bedürfe es einer "Ethik des Blicks" (S. 156), mit der den Bildern zu begegnen sei. Um die so gewonnene Erkenntnis vom Spezialfall des fotografischen Mediums auf eine allgemeinere Ebene der Bildlichkeit zu heben, folgt Schwarte den "meisten aktuellen Bildtheorien" und definiert Bilder als "sichtbare Strukturen […], die sich von den Bildträgern als ihren Medien abheben" (S. 153). Es gelte, nicht die Unterschiede zwischen den einzelnen visuellen Medien hervorzuheben, sondern das Hauptaugenmerk mehr auf jene Gestaltungsmerkmale und Eigenschaften zu richten, die allen Bildern gemein sind. Ein derartig verbindendes performatives Potenzial bestehe in der dem Visuellen eigentümlichen Kraft zur Gestaltung einer über die Gegenwart in andere Zeitschichten ausstrahlenden Präsenz, die die Wahrheitsfähigkeit der Bilder begründe.
Josef Früchtel beginnt seine Ausführungen zur "Evidenz des Films" und der "Präsenz der Welt" mit einer Revision der Deleuze'schen Kinobücher unter Einbezug postmoderner Theorie. Anhand der Zeitdimension des Augenblicks, an die sich die Epistemologie der Präsenz im Film knüpft, vollführt Früchtl einen Streifzug durch philosophische Definitionen von Evidenz, der sich hauptsächlich an Jean-Luc Nancys Filmessay orientiert. Demnach wird die Evidenz – als performativer Akt des Sichtbarmachens – durch ihr "plus qu'une vérité" zur Existenz: "Die Beweglichkeit des Blicks ist eine des Raums. Sehen heißt im Film vor allem, einen sich permanent verändernden, an die Zeit gebundenen Raum zu sehen und zu erfahren. Der Film bietet eine bewegliche bildhafte Raumerfahrung, eine bewegliche Raumerfahrung durch Bilder, die Erfahrung eines virtuellen beweglichen Raums" (S. 195).
Sebastian Rödl wiederum nimmt in seiner Response dazu Früchtls Überlegungen auf, um abseits vom Film und in grundlegender Manier (sprich mit Kant und Hegel) über Evidenz im Zusammenhang ästhetischer Erfahrung zu sprechen und warnt nicht zuletzt, sich die Sicht darauf durch den scheinbaren Gegensatz zwischen anschaulicher Evidenz und begrifflicher Erkenntnis nicht verstellen zu lassen.
Ebenfalls eine Revision filmästhetischer Klassiker (u. a. André Bazin, André Malraux und Erwin Panofsky) unternimmt Birgit Recki. Mit ihrem so geschilderten Ansatz vom "integralen Realismus" (S. 214) des Films und einer Diagnostizierung performativer Akte im filmischen Raum-Zeit-Kontinuum – "28 Tage nach der Infektion mit dem Performanzvirus" (S. 216) – analysiert sie Hitchcocks Rope (USA 1948). Dabei untersucht sie zuerst die Philosophie des Bösen (Friedrich Nietzsche) in der Handlung des Films, um – nach einem Exkurs über die Verwendung von Film in der philosophischen Disziplin – die Bedeutung des technischen Experiments, das diesen Film so exponiert in der Kinogeschichte dastehen lässt, mit in ihre Überlegungen einzubeziehen (der Film wurde in einer einzigen Einstellung auf acht zehnminütigen Rollen und ohne Schnitt gedreht). Daraus zieht Recki den synthetischen Schluss, dass sich eine Ästhetik der Performanz "bei Filmen wie bei Kunstwerken" (S. 226) an der Entsprechung von Form und Inhalt orientieren müsse.
Zwei weiteren Beiträgen im kinematografischen Kontext (von Gertrud Koch mit Untersuchungen der Performativität in verschiedenen Ebenen der filmischen Aufführung und Martin Seel mit einer Analogie von Film und Architektur) folgt Mirjam Wittmann mit "Erste[n] Überlegungen zur Performanz des Fotografischen", wobei sie die These entwickelt, dass das Verständnis und die Entlarvung der Fotografie als Konstrukt, das die Dichotomie von Material und Bild aufhebt, zu einer Verschiebung des Repräsentationsbegriffes führe, die in ihren Strukturen fotografische Performanz ins Rollen bringe.
Bettina Brandl-Risi untersucht das Beispiel der Tableaux vivants, "die weder nur Bild noch nur theatrales Ereignis, sondern beides zugleich" (S. 286) sind. Diese stellen eine Spezialform der performativen Wirklichkeitskonstitution auf visueller Ebene dar, die zudem "eine doppelte Prozessualität des Bildes in Bewegung, im Sinne einer Performanz im Bild und einer Performanz des Bildes" (S. 289) aufweist und für deren Analyse sowohl performative als auch bildtheoretische Verfahren anwendet.
Dem Beitrag von Brandl-Risi folgend sucht Matthias Weiss in der Konfrontation von Film und Gemälde ein Verständnis von Performanz zu finden, das sich "trotz aller Differenz für beide Bildformen geltend machen" (S. 332) lässt. Weiss beginnt mit der Analyse der abstrakten Interpretation des französischen Barockgemäldes Das Reich der Flora von Nicolas Poussin durch Cy Twomblys (Empire of Flora, 1961) und arbeitet sich so schrittweise zu Jean-Luc Godards Film Passion (FR 1981) vor, der die Geschichte eines von Tableaux vivants besessenen Regisseurs und dessen Scheitern erzählt, Gemälde filmisch nachzustellen. Weiss konstatiert "Gemeinsamkeiten in den Bildstrategien des Filmemachers" Godard und des Malers Twombly darin, "dass sie die Performanz ihrer Bilder im Sinne des jeweiligen Bildwerdens nicht nur zum Thema machen, sondern tatsächlich zur Anschauung bringen" (S. 351).
Wie man sieht, ist die Publikation aus dem Hause eikones um größtmögliche Vielfalt theoretischer und medialer Zugänge bemüht, bleibt dabei aber eher einem Konsensus verhaftet, der mit wissenschaftlicher Euphorie nun die Grundlagen dafür bereitgestellt hat, die Potenziale der Erforschung von Visualität unter dem Gesichtspunkt der Performativität weiter zu erschließen.
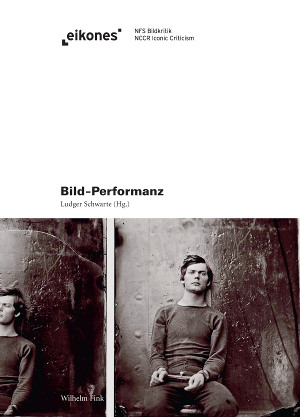
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



