Sandrine Fuchs (Hg.): watt. dance & performance 2 (März 2018).
Paris: White Spirit. ISSN: 2552-1977. 168 S. Preis: € 8,-.
Abstract
Watt, ein selbst-organisiert herausgegebenes Journal in französischer und englischer Sprache, versammelt in seiner zweiten Ausgabe bedeutende Stimmen der zunehmend virulenten Diskussion um so genannte „practices“, das heißt um Praktiken aus dem experimentellen Tanz- und Performancebereich mit spezieller Prägung. Diese verheißen nämlich eine Emanzipation des künstlerischen Handelns von der Bühne, vom Format der Aufführung, womöglich sogar vom theatralen Prinzip als solchem. In Gesprächen unter Künstlerinnen – es sprechen ausschließlich Frauen – entfaltet sich ein Diskurs über das Was und Wie der „practices“, der zugleich eine Kultur des Austauschs und Experiments vermittelt und damit einen umfassenden Einblick in ein künstlerisches Milieu und seine näheren Umgangsformen gibt. Was aber ist unter „practices“ zu verstehen? Und in welchem Verhältnis stehen sie zur gewählten Verhandlungsform von Künstlerin zu Künstlerin?
Das Journal watt hat eine junge Geschichte: ohne Verlag im Hintergrund wurde es im Frühjahr 2017 von den Tanzkritikerinnen Charlotte Imbault und Fanny Lacour aus der Taufe gehoben, wobei Imbault seither als Chefredakteurin fungiert, während Lacour nur Herausgeberin der ersten Ausgabe war und bereits für die zweite Ausgabe von Sandrine Fuchs ersetzt wurde. Durch den Sitz in Paris hat das Blatt einen französischen Schwerpunkt, was sich etwa in den bisherigen Produktionspartnern, dem Pariser Theater Méganerie de verre und dem Musée de la danse aus Rennes ausdrückt – dem Anspruch, eine dezidiert europäische Diskussion zu fördern, ist dies aber bis dato nicht abträglich. Mag der Titel watt Literaturkenner an Becketts gleichnamigen Roman erinnern, ist er jedoch, wie Imbault auf Nachfrage erklärt, primär von der Stromeinheit und dem physikalischen Formelzeichen W inspiriert. Er soll auf Energie und Arbeit verweisen, um damit die Produktionsästhetik von experimentellem Tanz und Performance als zentralen Gegenstand der Zeitschrift zu bestimmen. Im Fokus stehen das künstlerische Tun vom Konzept bis zu den Proben, dem Choreographieren, dem Performen, der Zusammenarbeit sowie der Rahmung dieses Tuns. Watt positioniert sich damit in einem Forschungsfeld, das in jüngster Zeit etwa anhand der Antwerpener Konferenz Tracing Creation (2016) oder durch Annemarie Matzkes Monographie Arbeit am Theater (2012) vorangetrieben wurde und sich anschickt, die Produktionsanalyse als vierte Säule der Theaterwissenschaft neben Aufführungsanalyse, Theatertheorie und Theatergeschichte zu etablieren.
Nicht zwingend, aber naheliegend ist die editorische Entscheidung, die Künstler selbst sprechen zu lassen, zumal ihre Arbeitsprozesse der Öffentlichkeit, der Wissenschaft und der Kritik selten zugänglich sind. Abgesehen von wenigen Interviews, die Chefredakteurin Imbault führt, geht die Linie von watt allerdings einen Schritt über das herkömmliche Künstlergespräch hinaus, da nämlich Künstlerinnen und Künstler untereinander sprechen und sich die journalistische Funktion auf die Kuratierung und die editorische Aufbereitung solcher Gespräche beschränkt. Ein kurzer Essay von Imbault ergänzt die Hefte, zudem wird in jeder Nummer einem Künstler oder einer Künstlerin in der Rubrik „White Page“ eine Carte blanche punkto schriftlicher Intervention eingeräumt.
Der selbstgewählte Rückzug der Redaktion auf die Rahmung künstlerischer Beiträge mag als ein Symptom der oft konstatierten Krise der Kritik verstanden werden, der Fokus auf das Gespräch auch als ein weiteres Beispiel der Inflation von Interviews allerorts, die mit dem postfordistischen Subjektivitäts-Imperativ der Virtuosität in Verbindung gebracht wurde (vgl. Diers et al. 2013). Aber die Setzung, Künstlerinnen und Künstler unter sich zu lassen, hat in diesem Fall Methode: „Thinking of orality as a tool: an act of declaration which both informs and transforms the reality of practice and/or prolongs the creative act“ (vgl. watt-Website unter „watt about“). Das Gespräch zwischen Künstlerinnen und Künstlern verweist auf die orale Kultur der Vermittlung in Tanz und Performance, wobei durch seine Transposition in die Schrift zugleich ein Element jener Transformation impliziert ist, die idealerweise der Effekt für die Sprechenden selbst und ihr Tun sein soll. Das Sprechen soll nicht allein Erfahrungen oder Wissen der Künstlerinnen und Künstler vermitteln, sondern wird zusätzlich als schöpferische, experimentelle und damit künstlerische Praxis verstanden.
In der ersten Ausgabe von 2017 findet sich dieser Anspruch noch zaghaft umgesetzt. Zwar wird in einem prototypischen Gespräch zwischen La Ribot und Volmir Cordeiro, das anstelle eines Editorials als Einleitung fungiert, durchaus das Potenzial des gemeinsamen Sprechens von Künstlerinnen und Künstlern angedeutet. Der erfahrungsgeleitete Austausch über das Wie, über das praktische Wissen des künstlerischen Tuns bringt offensichtlich differenzierte Aussagen über die singuläre Logik künstlerischer Entscheidungsprozesse hervor. Auch das Gespräch von Yasmine Hugonnet und Mathieu Bouvier in dieser Nummer leistet dies. In der Zusammenschau bleiben die fünf Gespräche aber eher unverbundene Einzelbeiträge ohne erkennbares gemeinsames Interesse. Und auch durch das in Imbaults Essay forcierte Thema der Sorge kann ein solches kaum gestiftet werden, weil die vertretenen Künstlerinnen und Künstler teils nicht explizit dazu arbeiten, dieses im Gespräch nur peripher berühren oder zu disparate Aspekte beleuchtet werden, beispielsweise der Umgang mit Angst im sozialen Gefüge der Probearbeit (vgl. das Gespräch von Alessandro Sciarron und Loz Santoro), oder aber die ganz anders gelagerte Verantwortung des Künstlers nicht allein für das eigene Schaffen, sondern auch für das Florieren seines künstlerischen Umfelds (vgl. das Gespräch von Rémy Héritier und Philipp Gehmacher).
Die zweite Ausgabe von 2018 ist demgegenüber konsistenter, was auch an der Gastredakteurin Myriam Lefkowitz liegt, die, selbst Künstlerin, Kolleginnen mit einem gemeinsamen Arbeitsinteresse zum Gespräch eingeladen hat. Das Verbindende liegt hier in der Reflexion der „practices“, wobei diese im experimentellem Tanz und der Performance nicht jede beliebige Art der künstlerischen Praxis bezeichnen. Jedes einzelne der wiederum fünf Gespräche erhellt nach und nach Facetten dieser „practices“. Dabei bestätigt sich zunächst, was Imbault tentativ in ihrem Essay festhält, nämlich: „A feeling of where it is growing happens outside stages, in another field than the spectacular“ (S. 162). In der Tat zeigt etwa das ausführliche Gespräch von Carolina Mendonca und Catalina Insignares zu der Arbeit us as a useless duet, die letztere 2016/2017 entwickelte, dass eine „practice“ das Ausüben von Tasks oder Körperübungen in einem Studio ohne Publikum bezeichnen kann, die keinen anderen Zweck als den der Ausführung selbst kennen, und die insofern „useless“ sind, weil sie nicht in eine Aufführung münden, nichtsdestotrotz aber sensorische Erfahrungen eröffnen, die nur durch die geteilte Aktion möglich sind. Zugleich berichtet Insignares aber vom imaginären Blick, der auch beim intimen Duo im Probenraum anwesend sein kann, womit sich der theatrale Vorgang des Zeigens auch dann manifestiert, wenn eine Trennung von Akteur und Publikum ebenso wenig gegeben ist wie eine Öffentlichkeit.
Lisa Nelson, die seit Jahrzehnten als Vorbild für die Arbeit mit „practices“ gilt, betont im Gespräch mit Yasmine Youcef einen weiteren Aspekt, nämlich, dass für „practices“ die Wiederholung, eine Routine kennzeichnend ist, oder wie Nelson sagt: „Unless I am going to do it every day, nothing is going to happen“ (S. 62). Barbara Manzetti hebt gegenüber Imbault die Bedeutung der Lebensnähe für ihr Tun hervor, besteht ihre „practice“ doch im täglichen Schreiben im direkten Kontakt mit ihrem sozialen Umfeld inklusive sozialen Randexistenzen wie Roma und Sinti oder Geflüchteten. Alice Chauchat und Moriah Evans, Mit-Organisatorinnen der Plattformen Nobody’s Business bzw. The Bureau for the Future of Choreography, veranschaulichen, was Praktikerinnen und Praktiker oft verbindet, nämlich der intensive Austausch von erlernten und erfundenen Praktiken. Damit werde weniger die Autorschaft einzelner negiert als vielmehr eine Verfügbarkeit der Praktiken für alle erzeugt. Autorschaft ohne jegliche Exklusivität der Verwendung wird außerdem von Valentina Desideri und ihrer Antwort auf die Carte blanche pointiert, da sie anhand von Beschreibungen bestehender Praktiken neue Tasks für Praktiken formuliert, die umzusetzen jeder eingeladen ist.
Insgesamt gibt die zweite Ausgabe von watt damit Einblick in ein experimentelles künstlerisches Milieu, in dem kollaborativ und langfristig an der Entwicklung künstlerischer Praktiken der zumeist sensorischen Involvierung gearbeitet wird. Einzig das Gespräch zwischen Myriam Lefkowitz und Alexandra Pirici fällt aus der sonst so stimmigen Diskussion heraus, da die diskutierte Arbeit von Pirici, Leaking Territories von 2017, eine herkömmliche Performance darstellt. Ungeachtet dessen leistet die Zeitschrift einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der „practices“, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil sie exemplarisch die Reflexion der Künstlerinnen vermittelt, die ohnehin oftmals in Diskussionen erfolgt, weshalb die basale Idee, Künstlerinnen mit Künstlerinnen öffentlich diskutieren zu lassen, besonders gut motiviert ist. Zusätzlich werden Gespräche als eigene „practice“ der Künstlerinnen erfahrbar und damit als künstlerisches Format. Der künstlerische Diskurs muss nicht zwingend an propositionalen Aussagen, Thesen und Argumenten interessiert sein, sondern kann schöpferisch, potentiell „useless“ und keinem Zweck unterworfen sein – was Erkenntnisgewinn jedoch nicht ausschließt.
Watt ist in ausgewählten Europäischen Kunstbuchhandlungen erhältlich, beispielsweise der Buchhandlung Walther König in Berlin, kann aber auch über die Journal-Website bestellt werden: http://w-a-t-t.eu/.
Referenzen:
Diers, Michael/Lars Blunck/Hans Ulrich Obrist (Hg.): Das Interview. Formen und Foren des Künstlergesprächs. Hamburg 2013.
Matzke, Annemarie. Arbeit am Theater. Eine Diskursgeschichte der Probe. Bielefeld 2012.
Fuchs, Sandrine (Hg.): watt. dance & performance 2 (März 2018). Paris.
Lacour, Fanny (Hg.): watt. dance & performance 1 (Januar 2017). Paris.
http://w-a-t-t.eu, zuletzt abgerufen am 01.11.2018.
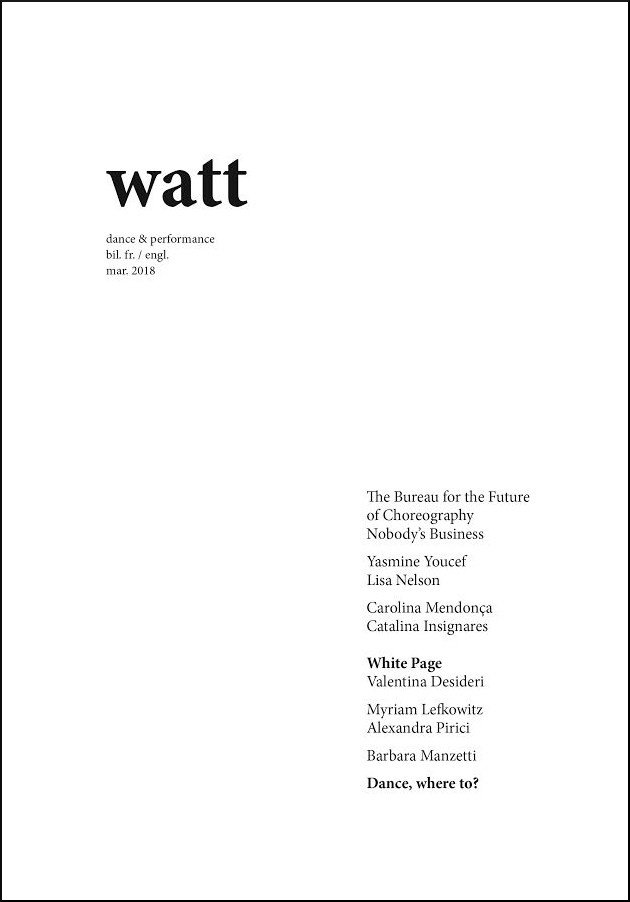
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2018 Georg Döcker

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



