Sarah Banet-Weiser/Kathryn Claire Higgins: Believability. Sexual Violence, Media, and the Politics of Doubt.
Cambridge/Hoboken: Polity Press 2023. ISBN: 9781509553815. 250 Seiten, 20,46 €.
DOI:
https://doi.org/10.25365/rezens-2024-1-07Abstract
Diskurse zu sexueller Gewalt waren immer schon postfaktisch.
Im Jahr 2016 verhandelt das Gericht Berlin Tiergarten einen Fall falscher Verdächtigung. Die Prominente Gina-Lisa Lohfink hatte zwei Männer beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. In geleakten Videoaufnahmen war der fragliche Sex zu sehen und zu hören wie Lohfink "nein" und "hör auf" sagt. Trotz dieses Beweises hielt die Staatsanwaltschaft sie für unglaubwürdig und erhob Anklage gegen sie. Es formierte sich feministischer Protest, der die deutsche Rechtsprechung medienwirksam als opfer- und frauenfeindlich kritisierte. Lohfink wird 2017 rechtskräftig schuldig gesprochen. Der Richter diskreditiert in seinem Urteil die feministische Kritik, die das Gericht als moralische Autorität der Wahrheitsfindung angezweifelt und Lohfink als Opfer misogyner Justiz definiert hatte. Er bezeichnet die Unterstützer*innen Lohfinks als eine "weitgehend desinformierte Öffentlichkeit", die sich im Bereich der "irrealen Welt alternativer Fakten" bewege. (Vgl. Spoerr 2017) Mit diesem Richterspruch, den ich als deutsche Rezensentin hier einbringe, ist ein Knoten angezeigt, den die feministischen Medienwissenschaftlerinnen Sarah Banet-Weiser (USA) und Kathryn Claire Higgins (GB) in ihrem Buch zum Ausgangspunkt nehmen: die Verknüpfung der Diskurse um sexuelle Gewalt, das Postfaktische ("post-truth"), Popfeminismus und der daraus in spezifischer Weise bedingte Diskurs um die Glaubwürdigkeit im Kontext sexueller Gewalt.
Die Autorinnen fokussieren das gleichzeitige Auftreten vom Postfaktischen – die mit der Trump-Regierung aufgekommene Bezeichnung für die öffentliche Angst um den Status der Wahrheit (S. 3) – mit der feministischen #MeToo-Debatte (im Original "#MeToo moment"), die mit dem viralen Hashtag im Oktober 2017 startete. Banet-Weiser/Higgins begreifen diese Gleichzeitigkeit als ein signifikantes, politisches Zusammentreffen ("conjuncture"). Der Begriff der "conjuncture" oder Konjunktur zeigt die Methode der Medienwissenschaftlerinnen an, die sich an Foucault und die Cultural Studies nach Hall anschließen. Banet-Weiser und Higgins begreifen Medien als relationale Artefakte, die sich in einer Kultur verbinden und deren historisch spezifische, kulturelle, politische und ökonomische Ermöglichungsbedingungen sie untersuchen. (Vgl. S. 16) Die Konjunktur, die sie in den Blick nehmen, "is conditioned by both histories and current struggles over who the 'doubtful subject' is, the 'crisis' of post-truth, and the spectacular capitalist visibility of networked media and social movements like #MeToo". (S. 16)
Banet-Weiser und Higgins analysieren rezente Medienproduktionen Post-#MeToo (TV, Serien, Film, in Kapitel 1), die Vermarktung von Selbstverteidigungsartikeln (pinkes Pfefferspray, Nagellack, mit dem Partygänger*innen ihre Drinks qua Fingereintauchen auf das Hypnotikum Rohypnol testen können etc. in Kapitel 2) sowie öffentlich und besonders online verhandelte Vorwürfe beziehungsweise Fälle sexueller Gewalt (unter anderen Depp v. Heard, R. Kelly, Cosby, Kavanaugh in Kapitel 3 und 4). Ihre Analyse von Glaubwürdigkeit und der aktuellen wie historischen Konstitution zweifelhafter Subjekte bleibt dabei stark auf die Diskurs- und narrative Inhaltsebene fokussiert. Audiovisuelle Ästhetiken und andere Medienspezifika blenden sie zugunsten einer breiteren Kulturanalyse (Post- und neoliberaler Feminismus, die Ökonomie privater Medienplattformen und kommodifizierendes Brand-Marketing, intersektionale Ungleichheit durch Klassifikationen nach race/class/gender) weitestgehend aus.
Die Autorinnen zeigen – und das macht ihre Arbeit besonders interessant – inwiefern Logiken und politische Affekte (Sara Ahmed) des Postfaktischen im Kontext der Diskurse um sexuelle Gewalt ihre Wirkung zeitigen und schon lange gezeitigt haben. Sie entwickeln daraus ihr Konzept aktueller, mediatisierter Glaubwürdigkeitsökonomie und eine sehr treffende Beschreibung von Glaubwürdigkeit im Kontext sexueller Gewalt: "Believability can't be 'fact-checked' as it is not (primarily) about the facts but, rather, about who those facts pertain to and whether or not those people are 'deserving' the kinds of recognition and solidarity that believability affords." (S. 150) Die Glaubwürdigkeit einer von sexueller Gewalt betroffenen Person hängt weniger von Beweisen ab als davon, ob sie ihre Betroffenheit überzeugend performt und ob sie ein Subjekt ist, das es verdient hat, Solidarität und Anerkennung zu erfahren wie auch umgekehrt, ob die der Tat beschuldigte Person als Täter*in überhaupt einer Diskreditierung ausgesetzt werden soll. Zum Beispiel kommen hier die Kategorie des Rassismus und die weiße Frau, die Männer of Color glaubhaft beschuldigen kann, ins Spiel (vgl. S. 170ff).
Die Arbeit der glaubwürdigen Performance findet seit #MeToo vermehrt auf den privaten Medienplattformen der Social-Media-Unternehmen statt, wo Betroffene den medienspezifischen Anforderungen entsprechend ihre digitalen "receipts" bereitstellen müssen (vgl. S. 138). In Kapitel 3 beschreiben Banet-Weiser und Higgins eine "digitization of doubt", worunter unter anderem die Fusion der Zweifel an der Authentizität digitaler Beweismittel (immer auch fälschbarer Text- und Sprachnachrichten, Fotos, Videos, Postings) mit den "cultural anxieties about the untrustworthiness of women" (S. 143) zu verstehen ist. Beiden, digitalen Medien und "Frauen", wird Manipulation und Täuschung zugeschrieben, sie geraten zum Objekt kultureller Faszination, Kontroverse und Zweifel. Die in Kapitel 2 analysierten, für die Marktzielgruppe "Frauen" produzierten Artikel wie "safe shorts" mit Schloss oder ein Armband, das mithilfe von Gestank Angreifende abwehren soll (S. 111), kritisieren die Autorinnen mit Bezug auf die Fehlschläge der Verteidigungsstrategien der Wahrheit in einer postfaktischen Kultur. Neben ihrer Konstruktion weiblicher Pflicht zur Selbstverteidigung (und der darin implizierten Mitschuld), spiegeln diese Artikel nämlich jene "most naive responses to 'post-truth' predicaments" (S. 115): hätten wir nur bessere Beweise (eine aufgebrochene Hose, einen stinkenden Angreifer), dann würden sie – "the (overwhelmingly) white men in charge" – es glauben und die Probleme ernst nehmen (S. 116).
Mit dem Fokus auf die "Believability", die Banet-Weiser und Higgins von der "Credibility" unterscheiden, erscheint die Krise der Wahrheit gerade nicht als eine der Epistemologie – der Wissbarkeit und des Mangels an Beweisen – sondern "as a crisis of subjectivity" (S. 18). Sexuelle Gewalt wird als radikal kontingent und endemisch zweifelhaft konstruiert, womit die Faktizität der Erfahrung sexueller Gewalt (mitsamt ihrer Beurteilung als gewaltvoll und verletzend sowie nicht bloß individuelles Pech, sondern als ein kollektives Problem) nie gesichert zu sein scheint. Alle drei Aspekte der Tatsache sexueller Gewalt (Erfahrung, Gewaltsamkeit, Kollektivität) beruhen auf der Glaubwürdigkeit der Aussagen von Betroffenen – im häufigsten Fall Frauen – deren Status als "doubtful subjects" jeden einzelnen Aspekt permanent zweifelhaft werden lässt. Banet-Weiser und Higgins verweisen somit auf eine historische Kontinuität des Postfaktischen in Bezug auf die Verhandlung sexueller Gewalt.
Durch Rassismus, Geschlecht und Klasse marginalisierte Subjekte leben nicht erst seit dem Ausruf des postfaktischen Zeitalters in einer Welt, in der die ihr Leben betreffenden Aussagen und Tatsachen stets bezweifelbar, beziehungsweise nie restlos aufklärbar erscheinen. Sie haben nicht zu wenig Beweise, um glaubhafte Zeug*innen ihrer (Gewalt)Erfahrung zu sein ("credibility"), sondern ihre Erfahrungen werden schlicht nicht zu "the kinds of facts that come to matter in public life" (S. 189). Marginalisierte Subjekte, die im Gegensatz zu jenen "in positions of privilege and power" (S. 19) vom rezenten unsicheren Status der Fakten also nicht überrascht sind, werden von den Autorinnen mithilfe etablierter, intersektional-feministischer Kategorisierungen bestimmt. Die "people from marginalized groups" sind entsprechend: "women, queer people, and people of color of all genders" (S. 7). Es ist empirisch zutreffend, dass es sich hierbei um jene Menschen handelt, die "regelmäßig als unglaubwürdige, nicht vertrauenswürdige und zweifelhafte Subjekte bestimmt worden sind" (S. 7, Übers. L. H., vgl. auch S. 18f). Doch auch um weniger Gefahr zu laufen, weitere Opfergruppen zu übersehen (Menschen mit Behinderung oder cis männliche kindliche Opfer werden von den Autorinnen nicht berücksichtigt), wäre es meines Erachtens gewinnbringend, ihre Marginalisierung nicht als Ursache ihrer Unglaubwürdigkeit zu setzen. Umgekehrt ließe sich, wie ich vorschlagen möchte, die Frage, inwiefern ihre Bestimmung als unglaubwürdig deren Kategorisierung als weiblich, unmännlich, nicht-weiß etc. erst zum Effekt hat, medienwissenschaftlich produktiv machen. An manchen Stellen im Buch gerät die Analysekategorie der Machtverhältnisse (race/class/gender), entlang derer die Glaubwürdigkeit auch nach ökonomischer Logik ungleich verteilt wird, zum Erklärungsprinzip. Die Analyse wird dadurch nicht falsch, jedoch verliert so das Vorhaben der Autorinnen, aktuelle und konkrete Untersuchungen der kulturellen Glaubwürdigkeitsökonomie vorzunehmen, stellenweise an Überzeugungskraft.
Banet-Weiser und Higgins gelingt mit ihrem Buch insgesamt ein spannender, umfangreicher Überblick über aktuelle englischsprachige, westliche mediale Repräsentationen, Diskurse und Vermarktungen ebenso wie über die Forschung zur Glaubwürdigkeit in Fällen sexueller Gewalt. Ihre Entscheidung, Ängste und Verhandlungen um das Postfaktische mit jenen um sexuelle Gewalt zusammen zu analysieren und darin historische Kontinuitäten sowie Aktualisierungen aufzuzeigen, ist überaus gewinnbringend und spannend.
Literatur:
Spoerr, Kathrin: "Gina-Lisa Lohfink – nicht Opfer, sondern Täterin". In: Welt.de, 10. Februar 2017. https://www.welt.de/vermischtes/article161986739/Gina-Lisa-Lohfink-nicht-Opfer-sondern-Taeterin.htm, aufgerufen am: 30.04.2024.
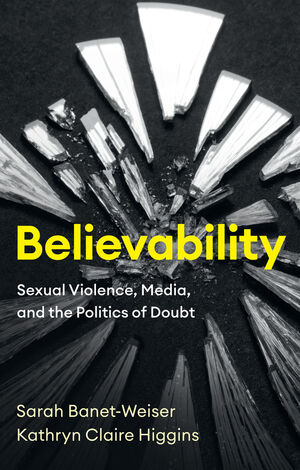
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2024 Louise Haitz

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



