Miriam Drewes: Theater als Ort der Utopie. Zur Ästhetik von Ereignis und Präsenz.
Bielefeld: transcript 2010. ISBN 978-3-8376-1206-6. 456 S. Preis: € 33,80.
Abstract
Auch wenn der Titel es nicht unbedingt nahelegen würde, legt Miriam Drewes mit der Veröffentlichung ihrer gekürzten Dissertation (2008 approbiert) eine detailreiche Auseinandersetzung mit einigen Grundpfeilern der modernen Theaterwissenschaft vor. Insbesondere geht es ihr darum, die 'ständigen Erweiterungen' des Faches über das Konzept der Theatralität hinaus hin zu einer 'Kulturwissenschaft' zu analysieren. Dabei zeigt sie Widersprüche, Kurzschlüsse und Denkfehler dieser Entwicklung auf und wirft einen kritischen Blick auf die gegenwärtige, sich dem postdramatischen Theater widmende Theaterwissenschaft.
Ein Hauptkritikpunkt von Drewes an den aktuellen Analysemodellen zeitgenössischen Theaters ist die Bevorzugung einer Ästhetik, der eine kausale 'Abstammung' von der 'historischen Avantgardebewegung' attestiert wird. Dies beobachtet die Autorin exemplarisch bei Hans-Thies Lehmann und Erika Fischer-Lichte anhand der von ihnen prolongierten "performativen Wende" der Theaterwissenschaft. Dabei würde "auf Theorieebene der ideologiekritsche Impetus der Künstler[_innen] affirmativ wiederholt" (S. 19). Die Bezeichnung "postdramatisch" geriete dabei zum "Erkennungs- und Vereinheitlichungsmerkmal einer vielschichtigen Ästhetik" (S. 14). In Abgrenzung zu theaterhistoriographischen Zugängen würde in den von Drewes untersuchten Modellen Lehmanns und Fischer-Lichtes die Gegenwart aufgewertet, wodurch Konzepte wie Präsenz und Ereignis ins Zentrum der Analyse rückten (vgl. S. 51).
Parallel zur Aufwertung der Gegenwart kann eine "Zunahme der Festivals, die sich explizit auf die Förderung avantgardistischer und innovativer Theaterästhetiken konzentrieren" (S. 20), beobachtet werden. In den von diesen Festivals verbreiteten Diskursen, so Drewes, sei ein ähnlicher Sprachgebrauch wie in der von ihr kritisierten theaterwissenschaftlichen Debatte anzutreffen: "Risikobereitschaft, Innovation und Avantgarde sind auch hier die wichtigsten Parameter" (S. 22). Durch die Herstellung einer Traditionslinie zur Avantgarde, werde die bei Festivals anzutreffende Ästhetik legitimiert, wie Drewes am Beispiel des Münchner Spielart-Festivals darlegt. Mit der Engführung des Fortschrittstopos und der Entwicklungslinie 'Avantgarde – Neoavantgarde – Performance Art/postdramatisches Theater' verschwinde aber "ein erheblicher Teil theaterästhetischer Phänomene zwangsläufig aus dem theoretischen Blickfeld" (S. 25). Die Folge sei zudem, dass die 'jüngere Theaterwissenschaft' Ideologiekritik und Metaphysikkritik bereits in den untersuchten Feldern anzutreffen vermeine und dadurch nicht auf die eigene Theoriebildung anwende, was zu einer "unauflösbare[n] Antinomie" (ebd.) führe.
So kann in der theatertheoretischen Debatte eine skeptisch zu betrachtende "Verlagerung von Transzendenz zu Immanenz" (S. 53) festgestellt werden. Diese führe zu methodischen Problemen bei der Analyse von Gegenwartserfahrung, wie Drewes im Kapitel "Fest und Utopie" am Beispiel der Festforschung aufzeigt. Dabei kritisiert die Autorin insbesondere die undifferenzierte Übernahme von Begriffen wie 'Liminalität' aus der anthropologischen Ritualforschung, wodurch die Unterschiede zwischen Ritual und theatraler Aufführung verwischt würden (vgl. S. 146). In der Reduzierung von Festen auf "den Ausnahmezustand der kollektiven Feier" in der "älteren Festforschung" und des "in letzter Konsequenz spirituell aufgeladenen Begriff[s] der ästhetischen Erfahrung in vielen zeitgenössischen Texten zum postdramatischen Theater" zeige sich letztlich, dass "über Funktion und Wirkungsweise von Präsenzerfahrungen" (S. 131) nur spekuliert werden könne.
Wird nun in der 'jüngeren Theaterwissenschaft' unreflektiert auf die Topoi Innovation, Fortschritt und Utopie Bezug genommen, dann werde damit eine eindimensionale Historiographie produziert, kritisiert Drewes. Die Absage an den "Kanon des mimetischen Theaters" (S. 35) evoziere zudem einen neuen Kanon, der sich an der behaupteten Teleologie von der Avantgarde hin zum postdramatischen Theater orientiere. Dies könne "dem ausdifferenzierten Unterhaltungs- und Sinnangebot postindustrieller Gesellschaften" (S. 147) nicht gerecht werden. Mit einer Diskurskritik auf Basis von Michel Foucault und Pierre Bourdieu versucht Drewes dazu einen Gegenentwurf zu entwickeln. Insbesondere mit Foucaults genealogischem Denken wäre eine Methodik aufzugreifen, die sich gegen Ursprungsdenken und lineare Verlaufsvorstellungen richtet (vgl. S. 37). Anstatt diese Fährte aufzunehmen, widmet sich Drewes in weiterer Folge allerdings einer ausführlichen Analyse und Kritik der "Historisierung und Kategorisierung zeitgenössischer Theoriebildungsprozesse", indem sie "geschichtsphilosophische Denkmuster" (S. 41ff.) unter Rückgriff auf eine Ideengeschichte der Ästhetik aufzudecken versucht.
Aus der kritischen Auseinandersetzung mit den Begriffen 'Ereignis' und 'Präsenz' leitet Drewes ab, dass in den damit verbundenen theaterwissenschaftlichen Debatten einer idealistischen, bisweilen quasi-mythischen Ästhetik das Wort geredet wird. Dies habe zur Folge, dass rationale Kriterien der Analyse aufgegeben werden. Für das Fach konstatiert die Autorin daher eine "wissenschaftstheoretische Strategie der Uneindeutigkeit" (S. 31). Dies ist eine durchaus prägnante Feststellung hinsichtlich jener Zugänge der Theaterwissenschaft, in denen die Flüchtigkeit der Aufführung ins Zentrum der Auseinandersetzung gerückt wird. Dieses weite Bereiche des Faches prägende Analyseproblem verleitet zur Beliebigkeit bei den auf die Transitorik des Gegenstandes aufbauenden Theorien. Aufrechterhalten wird dieser zweifelhafte Bezug auf eine transitorische Leerstelle auch im unkritischen Gebrauch der Analysekriterien 'Ereignis' und 'Präsenz' zur Beschreibung von postdramatischer Kunst bzw. nichtrepräsentativer Ästhetik.
Ihre Kritik an dieser Entwicklung versucht Drewes in Übereinstimmung zu bringen mit einer Begriffsgeschichte von "Theater als Ort der Utopie". Ausgehend von verschiedenen Ästhetiktheorien, die auf (negative oder positive) Utopien abzielen, gerät auch hier ein ums andere Mal eine – nun utopische – Leerstelle ins Visier, die Drewes in Beziehung setzt zu methodisch-theoretischen Uneindeutigkeiten in der Theaterwissenschaft. Um sowohl vereinfachende wie ideologische Deutungsmuster aufzudecken, argumentiert Drewes maßgeblich unter Bezugnahme auf diese vermeintliche Übereinstimmung von utopischem Horizont und flüchtiger Erfahrung. Besonders problematisch ist für die Autorin, dass in der Historiographie des postdramatischen Theaters "weitgehend linear auf die historische Avantgarde als Ursprungsgeschichte" verwiesen wird (S. 64). Meines Erachtens ist diese Verknüpfung von transitorischer und utopischer 'Leerstelle', wenn nicht ein Trugschluss, so zumindest eine verkürzte Analyse dieser beiden vielleicht ähnlich wirkenden, aber doch klar zu trennenden Konstrukte, insbesondere hinsichtlich ihrer jeweiligen Funktion in den sich darauf beziehenden Theorien.
So vermag dann auch das Aufmerksamkeit erweckende Unterkapitel "Die Transitorik: Glück und Dilemma der Theaterwissenschaft" nicht viel zur Klärung des damit verbundenden Methodenproblems beizutragen. Stattdessen konzentriert sich Drewes in Folge auf den Zeit-Begriff, um daraus "temporale Ordnungsmuster" zu entwickeln, die sie ihren Aufführungsanalysen zur Seite stellt (vgl. S. 316ff.). Dabei bezieht sie sich hauptsächlich auf Gérard Genettes Die Erzählung und ergänzt dessen Thesen mit Erkenntnissen der neueren Narrationsforschung. Die damit verbundene Absicht, ein empirisches, rational begründetes Analysemodell zu erstellen, vermag in den abschließenden Beispielen nicht zu überzeugen. Zu deskriptiv, wenn sie der Transitorik mit temporalen Ordnungsmustern beizukommen versucht und zu sehr in sich abgeschlossen, wenn sie die Luhmann'sche Systemtheorie heranzieht. Zwar werden zu Beginn der jeweiligen Analysen (Jérôme Bel: The Show must go on; Forced Entertainment: First Night; Alexeij Sagerer: Götterdammerung; Station House Opera: Roadmetal, Sweatbread) sowohl das jeweilige Thema der untersuchten Aufführung als auch die aufführenden Künstler_innen/Gruppen kontextualisiert, diese Darstellungen bleiben aber großteils darauf beschränkt, historische Linien abseits der Avantgarde zu legen.
Unklar bleibt zudem, gegen wen oder was sich Drewes' Kritik konkret richtet. Beispielsweise verwehrt sie sich in einem ausführlichen Kapitel zur historischen Avantgarde allgemein gegen "Ausschlusskriterien", die in der "Debatte um die Funktion der Kunst" (S. 202) ein einseitiges Bild der Avantgarde zur Norm erklären. Das hält Drewes aber nicht davon ab, in Folge eine ebenso – wenngleich andere Nuancen setzende – wirkmächtige Traditionslinie zu entdecken: nämlich jene der bedingungslosen Hinwendung zu utopischen Entwürfen, die zu einem "ideellen Absolutheitspathos avantgardistischer Teleologie" (S. 211) führe. Diese grundsätzliche Aversion der Autorin gegenüber allem 'Utopischen' durchzieht die gesamte Argumentation und der Verdacht liegt nahe, dass damit unausgesprochen auf eine andere Diskussion verwiesen wird, nämlich: Wie politisch soll/darf Theaterwissenschaft sein? Hier gibt es auf jeden Fall noch viel Diskussionsbedarf. Es ist aber fraglich, ob dies allein über eine Auseinandersetzung mit Theatertheorie abgehandelt werden kann. Meines Erachtens wäre es genauso wichtig, hier die Wirkmächtigkeit institutioneller Strukturen zu analysieren und die Positionen der Akteur_innen der deutschsprachigen Theaterwissenschaft in einem wissenschaftshistorischen und -theoretischen Kontext zu problematisieren.
Fazit: Alles im allem ist Theater als Ort der Utopie eine Arbeit, die einige wichtige Beiträge und Anstöße für die fachinterne Diskussion über theaterwissenschaftliche Theorie und Methodik bereithält, hingegen aber keine überzeugende Alternative zu den kritisierten Konzepten aufzeigt. Einige der von Drewes ins Feld geführten Punkte können dennoch nachhaltig überzeugen. Leider hält sie ihren kritischen Ansatz nicht konsequent durch; besonders bei von ihr favorisierten Theorien tendiert sie zu einer affirmativen Abhandlung. Zudem hätten Kürzungen und Straffungen der gut 450 Seiten starken Publikation der Thesenentwicklung gut getan. So sind besonders die ideengeschichtlichen Darstellungen zwar durchwegs kompetent, aber nicht immer erschließt sich deren Relevanz für das von der Autorin anvisierte Thema. Bisweilen gelingt es Drewes zudem nicht, die argumentativen Zusammenhänge konzise darzustellen, worunter die Entfaltung ihrer Position leidet. Abgesehen von diesem Manko gibt diese Analyse aber reichlich Stoff zur Diskussion und Hinterfragung aktueller Tendenzen der Theaterwissenschaft.
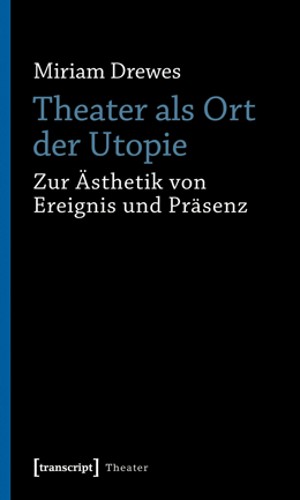
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



