Lorenz Aggermann/Georg Döcker/Gerald Siegmund (Hg.): Theater als Dispositiv. Dysfunktion, Fiktion und Wissen in der Ordnung der Aufführung.
Frankfurt am Main: Peter Lang 2017. (Reihe: theaomai. Studien zu den performativen Künsten 9). 978-3-631-71367-9. 276 S. Preis: € 58,60.
Abstract
Mit der Frage, was "im Zentrum des Faches Theaterwissenschaft zu stehen hat" (S. 7), beschäftigt sich der Sammelband Theater als Dispositiv, der aus der gleichnamigen Fachtagung am Institut für angewandte Theaterwissenschaft (Justus-Liebig-Universität Gießen) hervorgeht und zugleich Teil eines von Gerald Siegmund geleiteten DFG-Projekts ist. Unter dieser Frage werden inhaltlich und disziplinär diverse Artikel versammelt, die in keiner Weise blindlings affirmativ zu dem Projekt stehen, sondern dieses sowohl kritisch als auch vielseitig problematisieren.
Die Dringlichkeit der Klärung dieser Frage sieht Lorenz Aggermann in dem eröffnenden Beitrag "Die Ordnung der darstellenden Kunst und ihre Materialisation. Eine methodische Skizze zum Forschungsprojekt Theater als Dispositiv" (S. 7–32) im Gegenstand selbst verhaftet. Zunächst klärt dieser Beitrag, was 'nicht' im besagten Zentrum stehen könne, nämlich die von Erika Fischer-Lichte zum eigentlichen Gegenstand der Theaterwissenschaft erhobene 'Aufführung'. Sowohl die "ontologische Definition" als auch die "ästhetische Singularität" (S. 8) der Aufführung verhindere, "das Theater in seiner Gesamtheit in den Blick zu nehmen" (S. 10). Bei der nachfolgenden Etablierung von Theater als Dispositiv wird vor allem aus der französischen Philosophie geschöpft: Gaston Bachelard, Georges Canguilhem, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, Jacques Rancière, Jean-Louis Baudry und zuletzt – als nicht-französischer Vertreter – Giorgio Agamben geben die theoretische Rahmung vor (man könnte sich an dieser Stelle die Frage nach einem weißen, männlichen Dispositiv dieses Vorhabens stellen). Aggermann kommt zu dem Ergebnis, dass Theater "der paradigmatische Verhandlungsort von Dispositiven" sei, "gerade weil Theater nur als Dispositiv, als Konstellation von mannigfaltigen und heterogenen Elementen zu fassen" sei (S. 23). Dass solche Formulierungen provozieren sollen, ist angesichts der wissenschaftspolitischen Differenzen, von denen auch die Theaterwissenschaft betroffen ist, nicht apodiktisch zu bewerten. Hervorzuheben sind die umfassenden theoretischen Reflexionen des Beitrags von Aggermann, die durchdachte und notwendige Fragen an das Fach formulieren; letztere betreffen beispielsweise die Pluralität und Heterogenität von Theaterbegriffen, was eine Kritik wissenschaftlicher Monopolisierungen impliziert, sowie die institutionelle Prägung von Theaterformen und das damit jeweils einhergehende Theaterverständnis.
Im zweiten Beitrag "Die Performance in ihrem Element", der als weitere methodologische Grundlegung verstanden werden kann, verbindet Dirk Baecker den 'späten Foucault', d. h. den Sorge-Begriff, mit dem Dispositiv-Konzept, denn es gehe letztendlich "ums eigene Fleisch" (S. 34). Mit Rekurs auf George Spencer-Brown, Bruno Latour und dem Verweis auf vier Performances, die "eher zufällig herausgegriffen" (S. 36) wurden, stellt Baecker eine Formel der selbstreferentiellen und differenzierenden Kommunikation im Rahmen von Performances auf. Dieser knappe und theorieaffine Artikel entspricht dem zuvor geschilderten methodologischen Ansatz der Loslösung von der Singularität der Aufführung. Jedoch scheint sich gerade hier die Herausforderung für dieses Projekt zu zeigen, nämlich in dem Verhältnis von der Abstraktion der wissenschaftlichen Reflexion zur Konkretheit der Phänomene.
In dem darauffolgenden Abschnitt "Antike und moderne Konfigurationen" finden sich drei Beiträge, in denen auf unterschiedliche Weise eine historisierende Anwendbarkeit des Dispositiv-Konzepts vorgeführt wird. So versucht Andreas Hetzel mit "Theater als Dispositiv der Demokratie. Foucault liest Euripides" eine gewisse Revision der Foucault'schen Ion-Lektüre. Mit einer auf Kontinuität aufbauenden, ante-post-Argumentation, deren historisches Fundament an manchen Stellen differenzierter hätte ausfallen können, begreift der Autor Theater als eine Disziplinierungsinstanz von Publikum, Öffentlichkeit, Theaterschaffenden und AkteurInnen. Eine diachrone Anwendung des Konzepts hingegen skizziert Nikolaus Müller-Schöll mit "Das Dispositiv und das Unregierbare. Vom Anfang und Fluchtpunkt jeder Politik". Während Müller-Schöll bereits auf existierende theaterwissenschaftliche Arbeiten hinweist, die mit 'dispositiv-ähnlichen' Modellen operieren, stehen im Zentrum der Analyse die Theaterreformen um 1750 und der sog. 'performativ turn' der 1960er, die jeweils als "Ablösung eines Dispositivs durch ein anderes" (S. 75) verhandelt werden. Und zuletzt wird mit Ulrike Haß' Beitrag "Was einem Dispositiv notwendig entgeht, zum Beispiel Kleist" eine weitaus mehr auf historische Kontingenz basierende Reflexion aufgezeigt. Dabei übt die Autorin sowohl Kritik an Fischer-Lichtes Aufführungsbegriff als auch am hier verhandelten Dispositiv-Konzept, da Theater einen "Suchbegriff" (S. 93) darstelle, der sich nicht im Sinne eines Problemlösungskonzepts festmachen lässt, was anhand Heinrich von Kleists erklärt wird.
Das zweite Kapitel "Anomalie und Dysfunktion der Ordnung" versammelt Beiträge, die sich zum einen mehr philosophischen Abwägungen widmen und zum anderen selbst eine gewisse 'Dysfunktion' hinsichtlich des vorliegenden Konzepts darstellen. Den Foucault'schen Vorschlag Philosophie "nicht als Denken, sondern als Theater" zu betreiben (S. 105), führt Petra Löffler in ihrem Artikel "Theorie-Szenen: Eine (Wieder-)Aufführung" weiter. Gemäß dem angedeuteten Prinzip der Umwertung der Werte wird von der Autorin vorgeschlagen, nicht mehr Theater als Dispositiv sondern das "Dispositiv als Theater" (S. 117) zu denken, so dass hier auch eine offensichtliche Verlagerung der Perspektive angeregt wird. Eine genealogische Verschiebung des Dispositiv-Konzepts legt Matteo Pasquinelli mit seinem Artikel "Was ein Dispositiv nicht ist: Archäologie der Norm bei Foucault, Canguilhem und Goldstein" dar. In erster Linie widerlegt Pasquinellii – mit dem Fokus auf den Begriff der Normierung – Agambens "etwas abseitige[n] Umweg über die oikonomia der christlichen Lehre" (S. 126), um den fachlich-disziplinären Kontext des Dispositiv-Begriffs zu erschließen. Der hier letzte Beitrag "Dispositive als strategische Ordnungen ... und ihr Nicht-Scheitern-Können am Beispiel von Stanley Kubricks Dr. Strangelove" von Mirjam Schaub ortet die Grenzen des Dispositiv-Konzepts aus. Mit einer stärkeren Fokussierung auf Deleuze und am Beispiel von Dr. Strangelove zeigt Schaub auf, wie ein Dispositiv seine Selbstauflösung mitdenkt als "unfreiwillige, aber logische Selbstzerstörung" (S. 149) bzw. als strukturell eingeplante Vorwegnahme der eigenen Negation.
Das dritte Kapitel "Zeitgenössische Konstellationen" führt vor allem die kultur- und wissenschaftspolitischen Reflexionen fort. So versucht Yannick Butel in seinem Artikel "Theater als Dispositiv: Eine Alternative zum ideologischen Vorhang?" eine theoretische Begründung des "Brüchig-Werden[s] traditioneller Produktionsprinzipien und Rezeptionsmodi" (S. 161). In einer z.T. kulturpessimistischen Argumentation – mit einer kulturmoralisch überlegenen Note –, bei der Theater im Kontext von Kulturindustrie betrachtet wird, macht der Autor eine Verbindung zwischen Sprache und Theater auf. Das bereits hier angedeutete Verhältnis zwischen dem Diskursiven und Nicht-Diskursiven wird durch André Eiermanns Beitrag "Aspekte des Scheins im Dispositiv der Aufführung" ergänzt. Mittels des Dispositiv-Konzepts versucht der Autor eine offene Theaterdefinition zu formulieren, die sich gegen apodiktische Grenzziehungen ausspricht, indem eine "Wiederauffüllung des Dispositivs der Aufführung" (S. 187) zentral ist, d. h. mitunter die Wandelbarkeit und das Zusammenspiel von diskursiven und nicht-diskursiven Elementen. Einen anderen blinden Fleck der Theaterwissenschaft beleuchtet Birgit Wiens in "'Ausweitung der Kunstzone'. Das szenographische Dispositiv in den Künsten der Gegenwart". Mit einem Blick auf die Unterschiede zwischen Szenographie, Bühnenbild und die diversen Definitionen markiert Wiens zum einen die bisher spärliche Behandlung dieses Aspekts im Fach und zeigt zum anderen am konkreten Beispiel auf, dass die szenographischen Objekte mehr als bloße passive Gegenstände sind.
Der letzte Abschnitt "Akute Notstände" klingt existentiell bedrohlicher als er sich letztlich durch seine fachlich heterogenen Beiträge präsentiert. Zunächst stellt Alexander Jackob in seinem Artikel "Dispositive im Notstand? Ensembles zwischen Theater und Wissenschaft" Überlegungen zu einer Umbruchssituation der universitären Geisteswissenschaften an, die in die Thematisierung einer Wagner-Inszenierung von La Fura Dels Baus münden. Dabei wird eine Diskrepanz deutlich, indem eine 13 Seiten umfassende Theoriegrundlegung sich lediglich in einer kurzen Anwendung von drei Seiten zu bewähren hat. Im darauffolgenden Beitrag "Der radikale Einsatz (in) der zeitgenössischen Performance. Das Dispositiv der De-Subjektivierung" von Bojana Kunst stehen Fragen des 'Subjekts' im Zentrum. Essentielle zwischenmenschliche Ereignisse, wie Geständnis, Exzess oder Genuss, die als wesentlich für die Subjektivierung gelten, seien zu Teilen der Ökonomie und Industrie geworden, so dass die Autorin mit Fokus auf Agamben eine "Neubewertung der Performance als künstlerische Form" (S. 245) vorschlägt. Mit Christian Berkenkopfs Beitrag "Theologie und Dispositiv. Hermeneutische Überlegungen zu einem komplexen Zusammenhang am Beispiel der Sünde" wird in dem vorliegenden Sammelband die letzte Perspektive auf das Dispositiv geworfen, die ebenfalls das Subjekt prominent in die Analyse einbezieht. Mag dieser Artikel inhaltlich nur peripher mit theaterwissenschaftlichen Fragen zusammenhängen, so sind doch seine wissenschaftstheoretischen und methodologischen Betrachtungen auch für die Theaterwissenschaft relevant.
Theater als Dispositiv beinhaltet also ein weites Spektrum möglicher interdisziplinärer Zugänge. Von der Soziologie und Philosophie über die Film- und Medienwissenschaft bis hin zur Theologie wird ein fachlich weitreichendes Netz gespannt, das theaterwissenschaftliche Fragestellungen jedoch stets mitbedenkt. Auffällig erscheint dabei, dass sich mehrere Beiträge dezidiert mit den Grenzen oder einer möglichen Negation des Dispositiv-Konzepts beschäftigen. Eine derart kritische Auseinandersetzung spricht für das Gesamtprojekt, das damit weniger eine Zugangsweise postuliert, sondern vielmehr das Potenzial einer solchen umfassend auslotet. Die womöglich größte Herausforderung an das Projekt zeigt sich im Verhältnis zwischen den methodologischen Reflexionen und der konkreten Anwendbarkeit, denn zuweilen entsteht im vorliegenden Sammelband noch der Eindruck, die Methode könnte sich letztendlich auch selbst genügen.
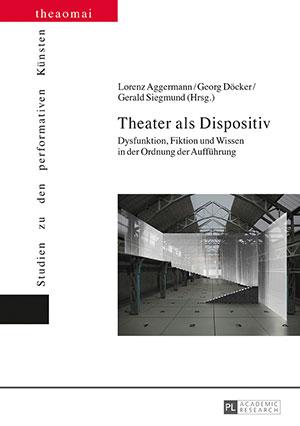
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



