James Shapiro: Shakespeare in a Divided America.
London: Faber & Faber 2020. ISBN: 978–0–571–33888–7. 320 S., Preis: € 23,99 (£ 20,00).
DOI:
https://doi.org/10.25365/rezens-2020-1-06Abstract
Dass 2016 der Republikaner Donald Trump als rechtmäßiger Vertreter einer demokratischen Öffentlichkeit gewählt wurde, wirkte sich auch dort aus, wo man es zuletzt vermuten würde: in den feinen Verästelungen des akademischen Schreibens über vierhundert Jahre alte Bühnentexte. Sucht man Phänomene der Gegenwart zu erklären, bieten Shakespeares Dramen eine beliebte Hilfestellung. Erst kürzlich veröffentlichte Stephen Greenblatt unter dem Titel TYRANT. Shakespeare on Politics die ausführliche Version eines Essays, der im Oktober 2016 unter dem gewagten Titel "Shakespeare Explains the 2016 Election" in der New York Times erschienen war. In der genauen und bisweilen etwas sprunghaften Lektüre von Shakespeares Dramen macht der Literaturwissenschaftler spezifische Figurenkonstellationen und Charaktereigenschaften aus. Daraus entwickelt er eine Typologie von "Ermöglichern", die tagespolitische Entwicklungen erhellen soll. In Shakespeare in Divided America wählt James Shapiro einen anderen Weg: Er untersucht, wie die szenische und analytische Behandlung von Shakespeares Bühnenfiguren in markanten historischen Momenten mit Themen und Ereignissen korreliert, die die Identität Amerikas ausmachen.
Die Motivation teilt er dabei mit seinem Kollegen Greenblatt. So gesteht Shapiro gleich auf den ersten Seiten: "It was the election of Donald Trump in 2016 that convinced me to write about Shakespeare in a divided America." (S. 8) Sein inhaltliches Fundament erhält dieses Verkaufsargument durch die 724 Seiten schwere Sammlung Shakespeare in America: An Anthology from the Revolution to Now, die der Autor vor sechs Jahren veröffentlichte. Das dort versammelte Material beginnt 1776, im Jahr der Unabhängigkeitserklärung, – die aktuelle Publikation eröffnet ein halbes Jahrhundert später mit den Konflikten um "Miscegenation", der Furcht vor einer 'Vermischung der Rassen', die dem bevorstehenden Bürgerkrieg den ideologischen Boden bereitete. Mit einem Artikel "On the Character of Desdemona" trug der ehemalige Präsident John Quincy Adams am Neujahrstag 1835 indirekt zu dieser Diskussion bei. Befeuert von der enttäuschenden Begegnung mit der vierzig Jahre jüngeren Schauspielerin Fanny Kemble, die seinen Ausführungen über Shakespeare keinen Beifall zollte, veröffentlichte er im American Monthly Magazine einen langen Brief. Darin wählt er den Umweg über seine bereits zuvor vielfach im Halbprivaten geäußerte Obsession mit Othello, um auszudrücken, "what he otherwise was too inhibited or careful to say" (S. 44): Desdemona habe ihr Schicksal verdient, weil sie sich des naturwidrigen Vergehens schuldig gemacht habe, einen "blackamoor" (S. 25) zu ehelichen.
Hier zeigt sich – und das ist die grundlegende Überzeugung Shapiros –, dass Shakespeare für die Ängste und Vorurteile, die das gesellschaftliche Klima prägen, als "canary in the coalmine" (S. 4) fungiert. So ist es folgerichtig, dass Shakespeare in America die 'hot topics' der Gegenwart – Race, Class, Gender, Sexual Orientation, Immigration, Otherness, Power & Politics – anhand der Aufführungs- und Rezeptionsgeschichte Shakespeares verhandelt. Auch Mental Health scheint zwischen den Zeilen immer wieder durch. Die Reflektiertheit, mit der Shapiro seine historische Rekonstruktion betreibt, würde man sich grundsätzlich von allen Autoren wünschen, auf die die Adjektive 'old white privileged male' angewandt werden können. Eben jene Aspekte sind es nämlich, die er ins Zentrum seiner kritischen Auseinandersetzung stellt.
Wenn es gilt, historische Machtverhältnisse zu analysieren, lohnt der Blick auf die Mächtigen: Shapiro beobachtet ein ausgeprägtes Näheverhältnis, das sämtliche amerikanische Präsidenten zu Shakespeare pflegten. Das Vorwort der Anthology schrieb 2014 übrigens Bill Clinton, jener Präsident, für den Monika Lewinsky zum Valentinstag 1997 eigens ein paar Liebesverse aus Romeo und Julia in die Washington Post setzte. 'Sämtliche', natürlich ausgenommen Donald Trump, "who may be the first American president to express no interest in Shakespeare" (S. 229).
Für Präsident Abraham Lincoln, federführend bei der Abschaffung der Sklaverei, verlief die Begegnung mit einem Schauspieler tödlich: John Wilkes Booth, jüngster Sohn einer Schauspielerdynastie, sah sich die Rolle des Brutus auch auf den Brettern der Weltbühne spielen. In der Loge des Ford's Theatre schoss er dem theaterliebenden – und im Privaten bevorzugt Shakespeare rezitierenden – Staatsoberhaupt in den Kopf. Booth war überzeugt von der Rechtmäßigkeit der 'Sklavenhalterstaaten' und erkannte in Lincoln seinen ultimativen Feind. Shapiro rekonstruiert die Entwicklung von Booth' politischem Fanatismus biographisch entlang seiner Auseinandersetzung mit Shakespeare: "Rather than playing introspective or noble parts (as his father and brother Edwin had), the only roles in which he distinguished himself were dark and often villainous heroes, men of action who die fighting. If a character wasn't scripted that way, he didn't hesitate to exaggerate these traits." (S. 133)
Fragen der 'Otherness' verhandelt Shapiro anhand der Aneignung von The Tempest, das wiederholt als "Shakespeare's One American Play" (S. 160) betitelt wurde. In der Figur Calibans, darwinistisch interpretiert als 'missing link' zwischen Wildheit und Zivilisation, wird das Fremde verortet, von dem wahlweise Gefahr ausgeht oder das es zu disziplinieren gilt. Das zeigt sich in zahlreichen Bearbeitungen und Adaptionen des Stückes. Dass in Shakespeares Dramen Gemeinschaft durch Ausschluss hergestellt wird, lässt sich auch in den Komödien nachweisen: "Community in Shakespeare's comedies depends – much like immigration policy – on who is barred admission as much as on who is accepted." (S. 151)
Worin der Autor die aktuelle Geteiltheit Amerikas ausmacht, erschließt sich am Ende des Buches anhand eines Zitats des Regisseurs Oscar Eustis, dessen Produktion von Julius Caesar Shapiro beratend begleitete: "Part of the divide is between those of us who believe in this democracy and those of us who believe that this democracy has utterly failed. And those that believe that it has failed believe they are victims, they are oppressed by the intellectuals, by the liberals, by the elite, and that that's the source of their problem." (S. 246)
Die sieben Kapitel lassen sich gut separat voneinander als eigenständige Essays rezipieren – jedoch zeigt sich in der Gesamtstruktur, dass ihr Verfasser seinen Shakespeare gelesen hat: Die narrative Klammer bildet besagte Produktion von Julius Caesar im Sommer 2017. In der Einleitung rollt Shapiro das Feld aus. Motiviert von der Wahl Trumps entschied Oscar Eustis, der Artistic Director des New Yorker Delacorte Theater, den gewaltsamen Sturz eines despotischen Herrschers in blonder Perücke und roter Krawatte auf der Bühne des Open-Air-Theaters vor 1.800 Menschen zu zeigen. Als Challenge für sein mehrheitlich liberales Publikum intendiert, sollte dem Mord an Caesar eine inszenierte Revolte von im Publikum stationierten Statist*innen folgen – dieser Theatervorgang wurde aber unvermittelt von der Realität überlagert: Die Rightwing Media griffen das Thema einseitig auf, der Widerstand gegen die Aufführung spitzte sich schnell zu. Erst in der Conclusio entfaltet Shapiro die ganze Geschichte und zeigt das verheerende Ausmaß von Social Media im Kampf gegen die Wahrheit. "CNN? Clinton? ISIS? Terrorism? It is hard to imagine a more irrelevant list of ideological or moral objections to the show. […] The crucial thing was not what was said but ensuring that the stunt would circulate on social media." (S. 240) Allein im Juni 2017 erreichte die Kontroverse auf Facebook über zwei Millionen Menschen.
Dass die gern herbeizitierte politische Sprengkraft des Theaters nicht bloß eine behauptete ist, wird umso deutlicher, weil Shapiro seine Leser*innen zwischen Einleitung und Schluss auf eine Zeitreise mitnimmt: Was 1846 in einem schottischen Theater als Privatfehde zweier Schauspieler-Egos begann – der Amerikaner Edwin Forrest pfiff den Briten William Macready während eines Hamlet-Monologes auf offener Bühne aus – entwickelte sich zu einem Flächenbrand, der drei Jahre später mit den Astor Place Riots seinen Höhepunkt erreichte. In die Aufstände rund um die Darstellung eines anderen Shakespeare Dramas, diesmal Macbeth, waren über 25.000 Menschen involviert. 31 kamen dabei ums Leben, 120 wurden verletzt.
Was war geschehen? Als Symbol des Britischen Königreiches, gegen das es sich aus Perspektive der weniger wohlhabenden amerikanischen Bevölkerung zur Wehr zu setzen galt, hatten sich der Engländer Macready und der amerikanische Nationalheld Forrest binnen dreier Jahre zu den Gallionsfiguren eines "Class Warfare" entwickelt. Ort der Handlung war ein neu erbautes Theater, das zum Flaggschiff des Klassenkampfes auserkoren wurde. Denn im Bau des Astor Place Opera House mit seinem weiß behandschuhten Publikum spiegelte sich ein neu erstarkender Elitismus: Um den Kontakt der sozialen Klassen möglichst zu unterbinden, waren die billigen Plätze vom "pit", "renamed the parquette" (S. 87), auf den vormals teureren Rang verlegt worden, der nun nur mehr durch separate Stiegenhäuser zu erreichen war – eine Umkehrung der Sitzordnung, die sich bis heute durchgesetzt hat. Als Macready in diesem Gebäude eine Serie von Shakespeare-Gastspielen antrat, die Forrest im Übrigen in einem benachbarten Theater spiegelte, rief dies wüste Proteste hervor.
Es ist die Kombination aus historischer Detailgenauigkeit und gegenwärtigem Blick, mit der Shapiro das Geschehen lebendig macht: Am ersten Abend der Riots spielten die stoischen Schauspieler*innen das Stück stumm zu Ende, als sie merkten, dass ihre Stimmen sich gegen den Tumult auf der Galerie nicht durchsetzen konnten. Am nächsten Tag wurde der Widerstand physischer; Eier flogen aus dem Zuschauerraum. "Potatoes followed, along with lemons, apples, an old shoe, and a bottle of asafetida, a foul-smelling spice, that splashed Macready's costume." (S. 94) Erst als die Bestuhlung auf die Bühne geworfen wurde – "Macready didn't have the luxury of knowing that the chairs crashing onstage a few feet from where he stood weren't meant to hit him" (S. 95) – brach der standfeste Engländer die Vorstellung ab.
In die atmosphärische Rekonstruktion des Zeitgeistes flicht Shapiro immer wieder heutige Perspektiven ein. So auch in seinen Ausführungen über die Schauspielerin Charlotte Cushman: "As is so often the case in the theater, there was a gap between what people saw and what they projected upon the performers or simply imagined seeing. A video clip of Cushman's performance would no doubt disappoint, failing to capture its allure." (S. 67) Die Gründe für diese 'Projektion' entfalten sich im Kapitel "Manifest Destiny", jenem Leitspruch, der Amerikas gottbestimmte Dominanz über den gesamten Kontinent legitimieren sollte. Im Kontext territorialer Ausdehnung wirft der Autor ein Licht auf die Geschichte jener weiblichen Darstellerinnen, die für einen kurzen Moment der Geschichte als Romeos und Hamlets die amerikanischen Bühnen betraten – laut Shapiro, weil sich das fragile männliche Ego in Zeiten des Bürgerkrieges von schwachen und wankelmütige Helden akut gefährdet sah.
Über die Schauspielerin Cushmann – die mit 23 zum ersten Mal als Romeo neben ihrer jüngeren Schwester auf der Bühne stand und diese Rolle für weitere 20 Jahre verkörpern sollte – transportiert Shapiro einerseits die Stimmung der Bevölkerung in Zeiten des Krieges und andererseits die private Biographie einer Frau, die im 19. Jahrhundert ihre berufliche Existenz auf Schauspielerei gründete. Auch wenn sie eine gleichwertige Gage zur Bedingung machte, war ihre Position als alleinstehende Berühmtheit, die sich anmaßte, Männerrollen auf der Bühne zu verkörpern, stets gefährdet. Die durch private Korrespondenzen gut dokumentierten Beziehungen, die sie zu anderen Frauen unterhielt, musste sie stets so kaschieren, dass ihr Liebesleben nicht zur existenzbeendenden Schlagzeile wurde.
Mit dem Waffenstillstand veränderte sich die öffentliche Wahrnehmung: "Martial manliness was, many now saw, a hollow and dangerous thing." (S. 72) In unmittelbarer Folge bildete sich auf der Bühne eine ähnliche Verdrängung ab, wie sie mit Ende der beiden Weltkriege auch in Europa zu beobachten war: Aus den beruflichen Positionen, die Frauen in Abwesenheit der Männer eingenommen hatten, mussten sie sich wieder zurückziehen. "Once men could comfortably play a Romeo who could at times appear effeminate, they reclaimed the role." (Ebd.)
Cross-Dressing ereignete sich aber auch in umgekehrter Richtung: Als 1845 die Disziplin der im Camp Corpus Christi Stationierten sukzessive zu zerfallen drohte, wurde von einem umsichtigen Kommandanten ein Armeetheater gegründet. Mithilfe von Othello, dessen Militärszenen die Lebenswirklichkeit der Soldaten reflektierten, sollte die Moral der Wartenden gehoben werden. In Ermangelung einer weiblichen Besetzung begab man sich auf die Suche in den eigenen Reihen. Gefunden wurde das Substitut im späteren Präsidenten der Vereinigten Staaten, Ulysses S. Grant, "because of his looks and perhaps his voice too" (S. 49). Zur Aufführung kam es trotz dieser offensichtlichen Qualifikation jedoch nicht, da der Othello-Darsteller sich weigerte, mit Grant zu spielen – aus Angst, unter Homosexualitätsverdacht zu geraten.
Weitere Berührungspunkte von Homosexualität, Emanzipation, Marginalisierung und Theater treten im Kapitel über das Musical Kiss me Kate zutage, das auf Shakespeares sperriger Komödie The Taming of the Shrew basiert. In diesem Backstage-Frontstage-Drama kam es 1948 für einen kurzen Moment der Geschichte auf der Bühne zur friedvollen Koexistenz unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten: "The defining feature of the Shakespeare musical was its hybridity – mixing musical styles, mixing Shakespeare's language with contemporary American idiom, mixing races, and mixing highbrow, middlebrow, and at times lowbrow." (S. 183) In der Verfilmung des Musicals wurden diese Unterschiede fünf Jahre später jedoch zugunsten eines Mainstream-Leinwanderlebnisses wieder homogenisiert.
Zur Kontextualisierung der Themen "Adultery and Same Sex Love" bezieht sich Shapiro auf Erhebungen des Gallup Instituts und kontrastiert diese mit Zahlen zu tatsächlicher Untreue. Die aktuellsten Daten zum Wertekanon der USA stammen aus dem Jahr 2015 und besagen: "To give some sense of American's disapproval of infidelity, no other behavior that was polled was considered less morally acceptable – not even human cloning, suicide, or abortion." (S. 214) Ein großer Teil des Kapitels gilt der Analyse der Drehbuchentwürfe zu Shakespeare in Love (R.: John Madden, UK/US 1998) und den in den verschiedenen Fassungen wirksamen Moralvorstellungen. Die Fiktionalisierung rund um Shakespeares Gender-Swap-Komödie Twelfth Night verwebt Shapiro mit dem Produktionsgeschehen – Homosexualität in Hollywood! Harvey Weinstein! – und Bill Clintons Impeachment-Prozess, der im Jahr des Kinostarts die Weltöffentlichkeit bewegte.
Es ist unmöglich, über Shakespeare zu sprechen, ohne die eigenen innersten Haltungen zu verraten. "Shakespeare's plays are rich in the extremes of experiences – injustice, separation, violence, revenge." (S. 7) Daher werden persönliche Überzeugungen, Misogynie, Rassismen und Intoleranz angesichts seiner Stücke so sichtbar wie sonst allenfalls nach dem fünften Bier, erläutert Shapiro im Podcast der Folger Library, der das Erscheinen des Buches begleitet.[1] Die Stärke der Publikation liegt nicht allein in der ungemein kenntnisreichen Kontextualisierung, sondern in der Lebendigkeit des Eindrucks, den man beim Lesen davon erhält, wie sich die öffentliche Wahrnehmung der shakespeareschen Figuren im Kontext bestimmter gesellschaftlicher Konstellationen verändert hat. Während sich rekonstruierende Versuche eines 'original practice style' meist auf die getreue Umsetzung von Raum, Requisiten, Kostümen und womöglich Spielweisen beschränken, trägt die Lektüre von Shakespeare in a Divided America dazu bei, das Mindset der Menschen zu einer spezifischen Zeit an einem spezifischen Ort besser zu verstehen.
Auf 250 Seiten (plus 50 Seiten kommentierte Bibliographie) erzählt Shapiro eine dichte Geschichte Amerikas, bei der man en passant Erstaunliches aus der Aufführungsgeschichte Shakespeares, viel mehr aber über die enge Verwobenheit von Theater und Gesellschaft erfährt. Dass er dabei die Rolle Shakespeares mitunter ein wenig überschätzt, ist man ob der Kraft der Narration schnell zu vergeben bereit. Nach der Lektüre dieses Buches hat man eine Menge erlebt. Und am Ende ist man mit Shapiro überzeugt, dass wir von der Auseinandersetzung mit Shakespeare, der noch immer der meistgelesene Autor Amerikas ist, auch nach vierhundert Jahren beständig Neues über unser Menschsein lernen können.
[1] Barbara Bogaev/James Shapiro: "Shakespeare Unlimited: Episode 140". In: The Folger Library. 17.03.2020. https://www.folger.edu/shakespeare-unlimited/shapiro-divided-america.
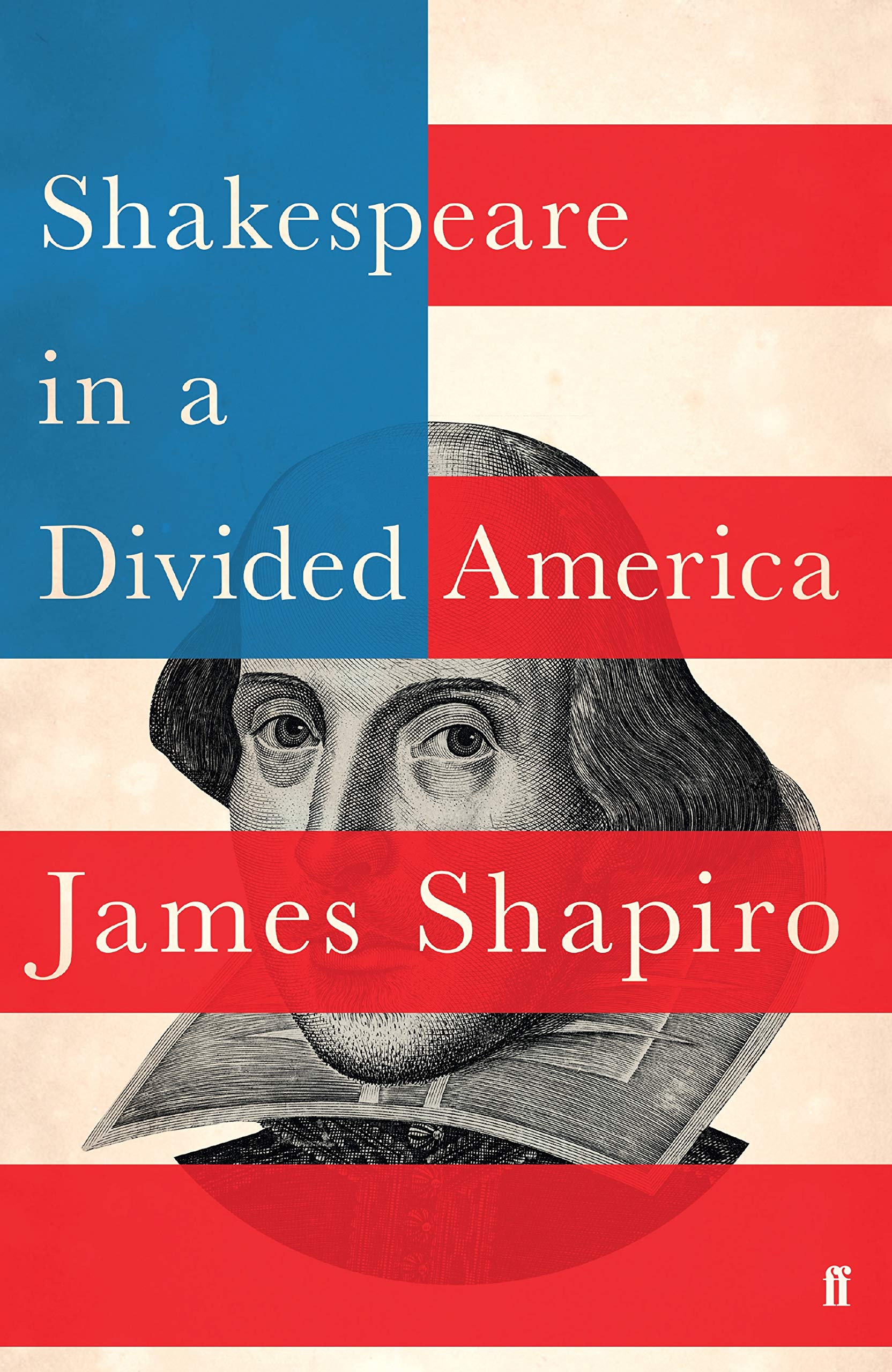
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2020 Stefanie Schmitt

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



