Marie Aline Klinger: Wasserprotokolle. Diffraktionen entlang der Mediterranean Frontier – ein Essay \\\\ Alisa Kronberger: Diffraktionsereignisse der Gegenwart. Feministische Medienkunst trifft Neuen Materialismus.
Marburg: Büchner 2024. ISBN: 978-3-96317-374-5. 140 Seiten, 19,00 € \\\\ Bielefeld: Transcript 2024. ISBN: 978-3-8376-6131-6. 346 Seiten, 94,00 €.
DOI:
https://doi.org/10.25365/rezens-2025-1-13Abstract
In den Publikationen Diffraktionsereignisse der Gegenwart (2022) von Alisa Kronberger und Wasserprotokolle (2024) von Marie Aline Klinger dient der Begriff der Diffraktion als Grundlage für eine explorative Auseinandersetzung mit feministischen und migrationspolitischen Fragestellungen in Kunst und Aktivismus. In beiden Texten wird Diffraktion in Anlehnung an Donna Haraway und Karen Barad als Erkenntnismodell für Verschiebungen von Wahrnehmungen und Bedeutungszuschreibungen verwendet. Diese Verschiebungen wirken in den komplexen Dynamiken zwischen gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen und den damit verbundenen Perspektiven auf Natur und materiell-diskursive Grundlagen.
In der Physik bezeichnet Beugung den Prozess, bei dem Wellen, z. B. Licht oder Wasser, an einem Hindernis oder durch einen Spalt gebeugt werden und sich dabei in verschiedene Richtungen ausbreiten und Interferenzen mit anderen Wellen erzeugen. Im Neuen Materialismus wird die Beugung als Denkfigur verwendet, um die komplexen und dynamischen Beziehungen zwischen Materie, Wahrnehmung und Bedeutung neu zu fassen. Die diffraktive Methode zeichnet sich durch eine Abkehr von traditionellen Herangehensweisen aus, die häufig nach festen Kategorien und stabilen Bedeutungen suchen. Stattdessen zielt sie darauf ab, die ständigen Verschiebungen und Verformungen von Wahrnehmung und Bedeutungszuschreibung darzustellen und zu untersuchen. Ein zentrales Merkmal der diffraktiven Methode ist die Ablehnung binärer und dualistischer Denkmuster. Klassische Dichotomien wie Körper/Geist, Natur/Kultur oder Subjekt/Objekt werden in der diffraktiven Analyse nicht als stabile, voneinander getrennte Kategorien verstanden, sondern als miteinander verwobene, fließende und sich ständig verändernde materiell-kulturelle Prozesse. Diffraktion wird als eine Form der Beugung und Streuung von Bedeutungen interpretiert, in der die Trennlinien zwischen verschiedenen Konzepten und Kategorien immer wieder aufgelöst und neu verhandelt werden.
Die diffraktive Methode stellt die These auf, dass Wissen und Bedeutung nicht lediglich "reflektiert" werden können, sondern vielmehr durch die Wechselwirkungen von menschlichen und mehr-als-menschlichen Akteur*innen, beispielsweise Forscher*innen, Diskursen und materiellen Gegebenheiten, aktiv hervorgebracht werden. In diesem Zusammenhang wird das Konzept der "Intra-Aktion" von Barad relevant. Nach Barad sind es die Handlungen und Interaktionen dieser verschiedenen Akteur*innen, die die Welt konstituieren. Es gibt keine objektive Wahrheit oder ein stabil determiniertes "Wesen" der Dinge, sondern die Wirklichkeit und ihre Wahrnehmung werden durch die permanenten Wechselwirkungen unterschiedlicher Kräfte und Perspektiven erzeugt. Diffraktion wurde von Haraway und Barad als zentrales analytisches Konzept entwickelt, um modernistische Dichotomien in den Kulturtheorien zu überwinden. Diese Dichotomien gehen letztlich alle auf eine scharfe Trennung zwischen Natur und Kultur, Ontologie und Epistemologie zurück (vgl. Deuber-Mankowsky 2011, S. 85ff).
Kronberger thematisiert die Wechselwirkungen zwischen feministischer Medienkunst und neuem Materialismus und fragt, wie sich daraus Impulse für eine Weiterentwicklung der diffraktiven Methode für das kunst- und kulturwissenschaftliche Fächerspektrum ergeben. Ihre Auseinandersetzung zeigt, wie sich die vielschichtigen Verschiebungen in der Wahrnehmung von Körpern, Geschlechtern und Materie in der zeitgenössischen feministischen Medienkunst seit den 1960er und 1970er Jahren unter anderen Vorzeichen (neu) fassen lassen. Klinger verwendet in ihrem Essay die Beugung als Denkfigur, um das auf Wasser basierende Grenzregime der Mittelmeerküste und der Fluchtrouten der Mediterranean Frontier zu untersuchen. Bilder und Imaginationen des Wassers und des Meeres werden zu Prismen für die Komplexität eines biopolitischen Regimes, das sich im Aufeinandertreffen politischer, sozialer, kultureller und ökologischer Dimensionen herausgebildet hat. Die Analyse umfasst sowohl die kulturhistorischen als auch die politischen Auswirkungen des Grenzregimes und beleuchtet die vielfältigen symbolischen Aspekte von Wasser und Meer in Bezug auf diese dynamischen und umkämpften Grenzräume – und damit in Bezug auf Leben und Tod. Beide Texte liefern durch ihre jeweils unterschiedliche Auseinandersetzung mit Diffraktion hochinteressante methodische Impulse. Diese können dazu beitragen, die noch junge, nicht unumstrittene und in jedem Fall anspruchsvolle Perspektive der Diffraktion noch tiefer im Methodenarsenal der Kulturwissenschaften zu verankern.
Kronbergers Diffraktionsereignisse der Gegenwart. Feministische Medienkunst trifft Neuen Materialismus knüpft maßgeblich an neu-materialistische Konzepte von Haraway, Barad, Rosi Braidotti sowie Gilles Deleuze und Félix Guattari an, und entwickelt daraus einen interdisziplinären Ansatz, der die Wechselwirkungen von Feminismus und Materialität in der zeitgenössischen Medienkunst beleuchtet. Unter der Überschrift "matter and materiality matter" geht die Autorin der Frage nach, inwiefern materielle Prozesse und diskursive Praktiken die Wahrnehmung von Realität und Subjektivität prägen.
Im theoretischen Kapitel "Materiell diskursive Verschränkungen zwischen Feminismus, Kunst und Medien" entfaltet Kronberger eine präzise Analyse der Schnittstellen zwischen feministischen Theorien und dem Neuen Materialismus (vgl. S. 35-97). Sie bezieht sich dabei auf Barads Konzept des "agentiellen Realismus", um die Beziehungen zwischen Materie und Bedeutung als dynamische Verschränkungen zu verstehen, die die Welt nicht nur abbilden, sondern auch aktiv hervorbringen. Gleichzeitig wird der Einfluss von Haraways Konzept der "naturecultures" deutlich, das die untrennbare Verbindung von Natur und Kultur sowie die Bedeutung situierten Wissens für feministische Debatten betont. Der Begriff der "Assemblage" von Deleuze und Guattari wird verwendet, um die prozessualen Beziehungsgefüge zwischen Subjekten, Objekten und Technologien zu fassen, während Braidottis "nomadisches Subjekt" als Referenz für die Analyse fragmentierter und multipler Subjektivierungen dient.
Im ersten Analysekapitel, das den Titel "Privat/Öffentlich. Ist das Private noch politisch? – von implodierenden Dualismen" trägt, wird die zunehmende Auflösung klassischer Dichotomien im digitalen Zeitalter thematisiert (vgl. S. 99-153). Kronberger argumentiert in Anlehnung an Haraway und Braidotti, dass die Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit nicht (mehr) stabil sind, sondern sich in einem ständigen Aushandlungs- und Transformationsprozess befinden. Vor diesem Hintergrund wird die Frage nach dem Politischen des Privaten neu aufgeworfen.
Im zweiten Analysekapitel "Körper/Geist, Natur/Kultur: Durch den Körper hindurchdenken. Von verkörperten und situierten Akteur*innen im Gefüge von naturecultures" werden Haraways und Barads Konzepte der "naturecultures" und materiell-diskursiven Praktiken aufgegriffen, um die Rolle des Körpers als aktiven, situierten Akteur im Gefüge von Natur und Kultur zu beleuchten (vgl. S. 155-203). Dabei setzt sich Kronberger kritisch mit dem Dualismus von Körper und Geist auseinander und schlägt vor, diese Kategorien als diffraktive Muster zu lesen, die durch ihre gegenseitige Beeinflussung immer wieder neue Bedeutungen hervorbringen.
Das abschließende Kapitel "Repräsentation/Affekt, Subjekt/Objekt: Von affizierenden Maskeraden, gleißend tastenden Blicken sowie aufblitzenden und strömenden Bildern" verbindet Ansätze der Affekttheorie mit Überlegungen von Deleuze und Guattari zu Rhizomen (vgl. S. 205-297). Kronberger analysiert, wie mediale Repräsentationen durch affektive Dynamiken destabilisiert werden und neue Formen von Subjektivierung ermöglichen, die sich weder auf feste Identitäten noch auf stabile Bedeutungsstrukturen reduzieren lassen. Braidottis Figur des "nomadischen Subjekts" dient dabei als Bezugspunkt, um die fluide und prozesshafte Konstitution von Subjektivierung in einer von Medien und Technologien durchdrungenen Welt zu erfassen.
Die drei Analysekapitel bestehen aus Besprechungen von fünf bis acht künstlerischen Arbeiten, die der jeweiligen Überschrift zugeordnet wurden und durch diese thematischen Linsen Theoreme und Wahrnehmungen zusammenführen. Die Arbeiten werden nicht als abgeschlossene Werke, sondern als lebendige und performative Prozesse betrachtet, die helfen können, die Theorien von Haraway, Barad und anderen (feministischen) Denker*innen weiterzudenken.
Kronberger arbeitet intra-aktiv und analytisch mit den ausgewählten Kunstwerken, die sie als mehrdimensionalen Beitrag zum Verständnis feministischer Theorie und des Neuen Materialismus versteht. Ihr Ansatz zielt darauf ab, die Wechselwirkungen und Verschränkungen zwischen Materie, Diskurs und Repräsentation zu beleuchten und die künstlerischen Arbeiten als aktive Akteur*innen im Diskurs zu begreifen. Die verschiedenen Dimensionen von Materie, Körpern, Diskursen und Technologien in ihrer Beugung und Überlagerung sichtbar zu machen, ist als zentrale künstlerische Praxis der feministischen Medienkunst zu verstehen. Kronberger betrachtet die Arbeiten daher als Experimentierfelder, in denen materielle und diskursive Dynamiken in Wechselwirkung beobachtet werden können.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kronberger in ihrem Buch Diffraktionsereignisse der Gegenwart die diffraktive Methode umfangreich und sehr differenziert als einen hochproduktiven Ansatz nutzt, um die Verflechtungen von Feminismus, Medienkunst und Materialität zu untersuchen. Sie beleuchtet die fließenden und dynamischen Interaktionen zwischen diesen Bereichen und zeigt, wie durch die Verbindung von Theorie und Praxis neue Perspektiven auf die politischen und kulturellen Herausforderungen der Gegenwart gewonnen werden können. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Anwendung der diffraktiven Methode im Kontext der zeitgenössischen feministischen Medienkunst und des Neuen Materialismus, die in ihren Grundannahmen viele Parallelen aufweisen, bestehende Ähnlichkeiten bestätigt, anstatt produktive Differenzen zu erzeugen. Um eine tiefere diffraktive Wirkung zu erzielen, könnte es daher sinnvoll sein, weitere kontrastierende Perspektiven zu integrieren, die die theoretischen Überschneidungen zwischen den beiden Feldern herausfordern, um die Methode in ihrer vollen Komplexität und Kraft zu entfalten. Insgesamt stellt Kronbergers Arbeit einen herausragenden Beitrag dar, um die Zusammenhänge zwischen feministischer Medienkunst und Neuem Materialismus zu erfassen und die diffraktive Methode in ihrer möglichen Anwendung zu untersuchen.
Klingers Wasserprotokolle ist ein politisch aufrüttelnder und radikaler Text, der den diffraktiven Ansatz zur Analyse politischer Gewalt nutzt. In einer Zeit, in der die europäische Migrationspolitik und brutale Grenzregime immer wieder Gegenstand globaler Debatten sind, gelingt es Klinger, das Thema Wasser/Meer in einer interdisziplinären, komplexen und zugleich nuancierten Auseinandersetzung neu zu definieren. Mit ihrem diffraktiven Ansatz stellt sie lineare Denkweisen infrage und setzt auf eine Perspektive, die die Multidimensionalität von Wasser/Meer als politische Kraft sichtbar macht. Klingers Herangehensweise basiert auf einer kritischen Durchdringung verschiedener Ansätze. Im Gegensatz zu einer linearen, kausalen Analyse – etwa "Migration führt zu Toten im Mittelmeer" – untersucht sie das Thema anhand eines Forschungsdesigns, das sich aus der Verschmelzung verschiedener Wissenssysteme speist: Kunst, Film, Journalismus und Theorie. Die diffraktive Methode verweist darauf, dass verschiedene Perspektiven nicht nebeneinander existieren, sondern sich gegenseitig brechen, reflektieren und verzerren. In Wasserprotokolle manifestiert sich diese Erkenntnis in Klingers Integration komplexer theoretischer Verflechtungen, politischer Diskurse und künstlerischer Darstellungen.
Ein zentrales Element dafür ist der Umgang mit den Dokumentarfilmen Havarie (2016) von Philip Scheffner und Purple Sea (2020) von Amel Alzakout und Khaled Abdulwahed. Diese Filme stehen nicht für sich allein, sondern werden von Klinger als Katalysatoren genutzt, um eine breitere Reflexion über Wasser/Meer als materielle Grenze und gewaltförmiges Symbol anzustoßen. Wasser/Meer wird in diesem Zusammenhang nicht als Naturphänomen, sondern als fließendes, oft unsichtbares Element betrachtet. Durch seine Mehrdeutigkeit und seinen oft neutralen Status dient es dazu, die Gewalt an den Grenzen Europas zu verschleiern.
Ein diffraktiver Ansatz impliziert hier, dass politische Gewalt nicht statisch ist. Klinger verwendet den Begriff der "fluiden Gewalt", um die politischen Strukturen rund um Migration und Grenzpolitik zu beschreiben. Die Gewalt, die vom Mittelmeer ausgeht, ist demnach keine feste Größe, sondern ein dynamisches, sich ständig wandelndes Phänomen, das immer wieder "wogt", sich verändert und in unterschiedliche politische Diskurse eingebettet ist. Diese Transformation manifestiert sich nicht nur in physischen Gewaltakten, sondern auch in der symbolischen "Neutralität" des "natürlichen" Meeres, das in Wirklichkeit das am stärksten überwachte und politisch durchdrungene Gewässer der Welt ist. Die These, die Klinger mit ihrer Analyse verfolgt, ist, dass die vorherrschende Wahrnehmung von Gewalt als "klar" und "offensichtlich" infrage gestellt werden muss.
Die Auseinandersetzung mit dieser Fluidität wird auch auf der formalen Ebene des Textes sichtbar. Klinger verzichtet auf eine lineare Erzählweise und bewegt sich stattdessen in einem kontinuierlichen Fluss von Gedanken, Quellen und Perspektiven. So entsteht eine Art Kaleidoskop der europäischen Grenzpolitik, in dem nicht nur die "Toten im Wasser", sondern auch die unsichtbaren Praktiken und Machtstrukturen, die diese Gewalt hervorbringen, thematisiert werden.
Trotz der tragischen Darstellung von Gewalt ist Wasserprotokolle kein resignativer Text. Vielmehr öffnet Klinger immer wieder den Raum für Widerstand – allerdings nicht als festen, klaren Begriff. Widerstand wird im diffraktiven Ansatz nicht als monolithische Bewegung verstanden, sondern als eine sich ständig verändernde Praxis, die durch die Verschiebung von Perspektiven und die Infragestellung bestehender Machtstrukturen entsteht. Klinger verweist auf zivilgesellschaftliche Akteur*innen und Rettungsinitiativen, die im Mittelmeer gegen staatliche Gewalt agieren. Es ist dieser Widerstand gegen die Verdinglichung von Menschen und Wasser als etwas "Neutrales", der den diffraktiven Charakter des Buches unterstreicht: Widerstand entsteht nicht aus einer festen Position heraus, sondern in der Bewegung und im ständigen Hinterfragen von Macht und Gewalt.
Wasserprotokolle ist ein bemerkenswerter Beitrag zur politischen und theoretischen Debatte über Migration, Gewalt und deren Wahrnehmung. Durch ihren diffraktiven Ansatz gelingt es Klinger, die komplexen und oft unsichtbaren politischen Strukturen rund um die europäische Grenzpolitik zu entwirren und die fluiden Beziehungen zwischen Wasser, Macht und Widerstand zu beleuchten. Klinger bricht die traditionelle Analyse auf und zeigt, dass die Gewalt an den Grenzen nicht nur in den physischen Akten der Grenzüberwachung und ‑schließung liegt, sondern auch in den Symbolen und Wahrnehmungen, die unsichtbar gemacht werden. Wasserprotokolle ist ein durchdachtes, engagiertes und politisch relevantes Buch, das die Leser*innen dazu anregt, die europäischen Grenzregime aus einer diffraktiven Perspektive zu hinterfragen – als ein fließendes, widersprüchliches und sich ständig veränderndes gewaltvolles Gefüge.
Literatur
Karen Barad: "Diffraktionen. Differenzen, Kontingenzen und Verschränkungen von Gewicht" [Orig.: "Diffractions. Differences, Contingencies, and Entanglements That Matter", 2007]. In: Geschlechter Interferenzen. Wissensformen – Subjektivierungsweisen – Materialisierungen. Hg. v. Corinna Bath/Hanna Meißner/Stephan Trinkaus/Susanne Völker, aus dem Englischen von Sophia Theodor, Berlin/Münster: Lit Verlag 2013, S. 27-68.
Astrid Deuber-Mankowsky: "Diffraktion statt Reflexion. Zu Donna Haraways Konzept des situierten Wissens". In: Zeitschrift für Medienwissenschaft 4/1, 2011, S. 83-91. https://doi.org/10.25969/mediarep/2547.
Donna Haraway: Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan©_Meets_OncoMouse™ [Orig.: 1996]. New York/London: Routledge 2018 [2. Auflage].
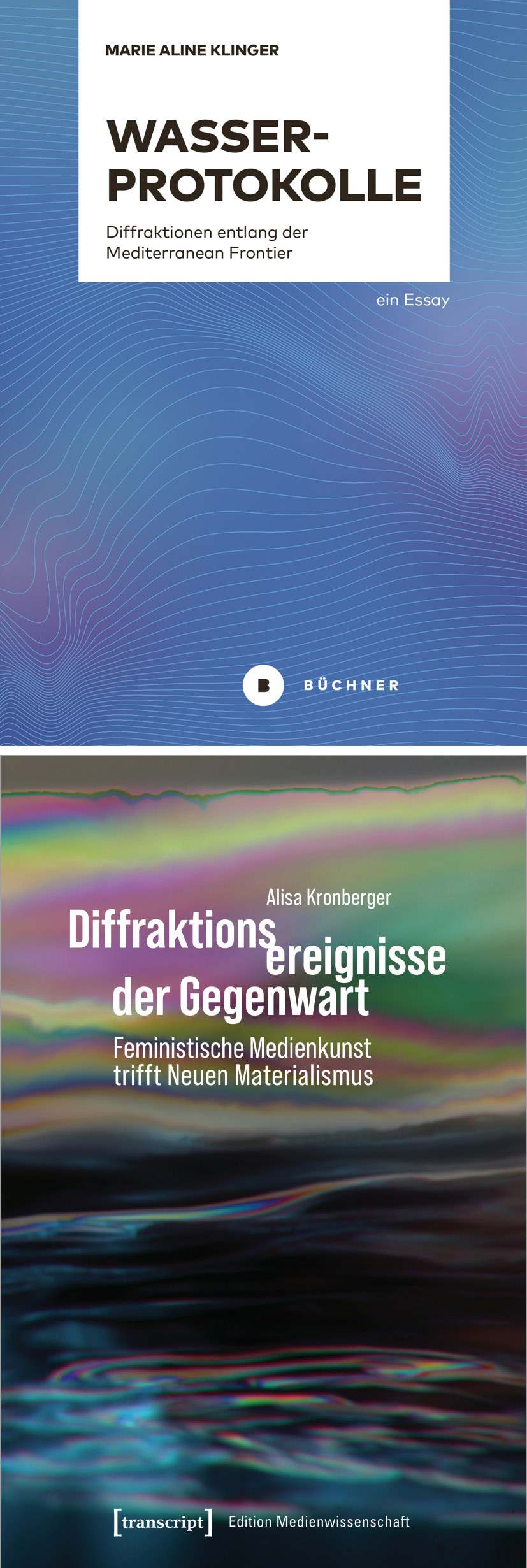
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2025 Melanie Konrad

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



