Stefanie Diekmann/Christopher Wild/Gabriele Brandstetter (Hg.): Theaterfeindlichkeit.
München: Fink 2012. ISBN 978-3-7705-5158-3. 209 S. Preis: € 29,90.
Abstract
Theaterfeindlichkeit als "unterschätzte[s] Phänomen" (S. 7) zu bezeichnen ist, was den deutschsprachigen Raum anbelangt, mit Sicherheit keine Übertreibung. Mit Ausnahme weniger AutorInnen, die natürlich in diesem Band vertreten sind (Doris Kolesch, Martin Puchner, Christopher Wild), hat die Theaterwissenschaft die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Theatrophobie und Theatromanie bisher weitgehend außer Acht gelassen. Auch wenn der vorliegende Band, wie die HerausgeberInnen im Vorwort anmerken, keine erschöpfende Betrachtung antitheatraler Impulse liefern kann, bietet er doch unterschiedliche Perspektiven, die allesamt theaterfeindliche Ideen und Handlungen "nicht als repressive, sondern als produktive Kräfte" (S. 8) betrachten und deren kulturgeschichtliche Bedeutung erkennen.
Gerade seine Gegner haben in der Vergangenheit häufig ein feineres Gespür für das Wirkungspotential des Theaters bewiesen als seine Verteidiger. Wie die Schriften letzterer für die Theaterhistoriographie nutzbar gemacht werden können, zeigen die Beiträge im ersten Abschnitt des Bandes, der – so der Titel – von der "Verführungskraft des Theaters" handelt. Zunächst befasst sich Doris Kolesch (nach ihrer Publikation Theater der Emotionen aus 2006) erneut mit der französischen Debatte über die Moral des Theaters im 17. und 18. Jahrhundert und konstatiert unter anderem ein Paradox, das auch in anderen Artikeln zur Sprache kommt, nämlich dass gerade theaterfeindliche Texte sich häufig eines durchaus theatralen Stils bedienen, um ihre Argumente durchzusetzen. Besonders deutlich wird dieser scheinbare Widerspruch im nächsten Beitrag von Stefanie Diekmann: Sie liest Rousseaus bekannten Brief an d'Alembert als Dokumentation der affektiven Aufladung des Mediums Theaters und schlägt aufgrund der Textstruktur vor, "den Brief selbst als ein Schauspiel zu betrachten" (S. 35). Der Eindruck einer nicht abschließbaren Auseinandersetzung mit den 'Gefahren' des Theaters, die Spannung zwischen Haupttext und Fußnoten des Briefes und die Dringlichkeit der Sprache führen sie zu dem Schluss, dass sich in der Ablehnung Rousseaus letztlich seine Liebe zum Theater artikuliert.
Das 'Hervorbrechen' der (während der Aufklärung verdrängten) Theatralität im 20. Jahrhundert zeigt Marcus Twellmann anhand des Salzburger Theaterstreits um die Aufführung von Hugo von Hofmannsthals Großem Welttheater. Hier kommt auch erstmals in diesem Band der religiöse Aspekt von Theaterfeindlichkeit zur Sprache, verortet Twellmann den Konflikt doch zwischen der barocken Theatertradition und dem latenten Protestantismus der (österreichischen) Theaterkultur – eine Opposition, die ihren Widerhall in der literaturwissenschaftlichen Unterscheidung von "Wortbarock" und "Bildbarock" (S. 43) findet. In Anlehnung an Franz Overbeck, der den Salzburger Theaterstreit "als österreichische Fortsetzung des deutschen Kulturkampfs" (S. 52) betrachtet, kommt Twellmann dabei letztendlich zu dem Schluss, dass nicht religiöse Inhalte Hofmannsthals Gegner auf den Plan riefen. Vielmehr musste sich das Medium Theater selbst der Kritik stellen.
Die entzaubernde Wirkung theaterfeindlicher Attitüden behandelt Christina Thurner in ihrem Artikel über den Bühnentanz und dessen Rezeption im 19. Jahrhundert. Sowohl in den Kritiken Théophile Gautiers als auch in den Erinnerungen der Tänzerin Margitta Roséri spürt sie desillusionierende Beschreibungen auf, die den Anschein der Leichtigkeit des Körpers ad absurdum führen.
Der zweite Abschnitt hat die "Produktivkraft der Theaterfeindlichkeit" zum Thema. Zunächst beschäftigt sich Björn Quiring mit Theaterfeindlichkeit im Elisabethanischen Zeitalter, einem "Symptom einer allgemeinen Krise traditioneller Identitäten und Repräsentationsformen" (S. 76), die im öffentlichen Diskurs ebenso wie auf der Bühne verhandelt wurde. Er wählt Shakespeares Othello aus, um die zuvor dargelegte "Komplizenschaft von Theater und Theaterfeindlichkeit" (S. 78) jener Zeit zu veranschaulichen. Zentraler Ansatzpunkt ist dabei die Figur des Iago, der als Regisseur der Intrige gleichzeitig verschleiert und enthüllt.
Dass auch Theaterreformen bzw. das Entstehen neuer Theaterformen und -genres durch antitheatrale Impulse angeregt und befeuert werden, zeigt David J. Levins Artikel am Beispiel Richard Wagners. In dessen Oper Die Walküre, so Levin, erzählt sich der Kampf zwischen der (französischen) bürgerlichen Oper (verkörpert durch Fricka) und dem Wagner'schen Konzept eines neuen Musiktheaters (verkörpert durch Siegmund), dessen ideales Publikum Sieglinde repräsentiert.
Abgrenzung gegenüber 'dem' Theater war es auch, die den Anreiz zur Entstehung der Performancekunst lieferte. Hans-Friedrich Bormann zeigt, dass die Unterscheidung aber gerade von Vertretern dieses Genres in ihren Performances zur Disposition gestellt und neu verhandelt wird und stellt sich die Frage, "welcher Erkenntnisgewinn mit der begrifflichen Opposition überhaupt verbunden ist." (S. 101). Er wirft einen auf das Moment des Unterscheidens fokussierenden "theatrale[n] Blick" (S. 102) auf Arbeiten von Marina Abramovic, Joan Hill und Mark Boyle sowie Hermann Nitsch. Indem Bormann z. B. den Scheincharakter auch in der Performancekunst ausmacht und so Performance und Theater einander (wieder) annähert, liefert er einen neuen Impuls für die Performativitätsforschung.
Mit der Verschiebung theaterfeindlicher Positionen in die Diskussion um ein anderes Medium beschäftigt sich Stefan Andriopoulos in seinem Beitrag über die Kinodebatte um 1900. Ausgehend von Gustave Le Bons Psychologie der Massen (1895) und dem medizinischen Diskurs zur Wirksamkeit von Hypnose zeigt der Autor, wie das Theater seine Bedeutung als Bildmedium nach und nach dem Kino gegenüber verliert, da dem Film aufgrund der ihm eigenen Gestaltungsmittel größere Suggestivkraft eingeräumt wird. Dass es gerade das (nicht neue) Verständnis von Theater als 'Wortkunst' (S. 13) war, welches u. a. die Ablehnung späterer PerformancekünstlerInnen hervorrief, ist jedoch ein Gedankenbogen, den zu spannen den Lesenden selbst überlassen wird.
Der "Theaterfeindlichkeit in transdisziplinärer Perspektive" widmet sich schließlich der letzte Abschnitt des Bandes. Beate Söntgen eröffnet den Blick über den fachlichen Tellerrand anhand der Auseinandersetzung mit Diderots "Modell der Innenräumlichkeit" (S. 127), das nicht wie das Konzept der Vierten Wand auf den Illusionseffekt abzielt, sondern deutlich macht, "dass der Betrachter immer Teil der Szene ist, die er betrachtet" (S. 128). Diderots Modell der kühlen, distanzierten Betrachtung leidenschaftlicher Emotionen soll so "für Darstellung in einem weiteren Sinne, also auch für die Malerei und auch für gesellschaftliche und private Kommunikation anwendbar" (S. 127) gemacht werden – ein Vorhaben, das nur ansatzweise gelingt.
Die Partizipation des Zuschauers hat auch Patrick Primavesis Beitrag zum Phantasma des antiken Theaterfestes um 1800 zum Thema. Primavesi skizziert auf wenigen Seiten die Ambivalenz der Antikerezeption der "Goethezeit" (S. 149), die sich zwischen utopischen Visionen und repräsentationskritischen Impulsen bewegt. Die Suche nach einem anderen Theater geht einher mit der Ablehnung zeitgenössischer, traditioneller Theaterformen, ohne dabei dem "Zirkel der Repräsentation" (S. 14) zu entkommen.
Auch Christopher Wild beschäftigt sich mit den Zusammenhängen zwischen (antikem) Theater und Politik. In seinem Beitrag führt er zwei Möglichkeiten, Theater und Tyrannis zu verbinden, in der Person des "Imperator Scaenicus Nero" zusammen: zum einen die klassische politische Theorie des "Tyrannen als Schauspieler par excellence auf dem Feld des Politischen" (S. 162), in der "die Differenz zwischen Amt und wahrer Natur den Tyrannen markiert"; zum anderen Blaise Pascals Überlegungen, die im Gegensatz dazu davon ausgehen, dass genau das Verwischen der Distanz zwischen Rolle (Amt) und Darsteller (Natur) zur Tyrannis führt. Er wirft damit nicht nur einen neuen Blick auf das Prinzipat Neros, sondern auch auf einen Vorwurf, der dem Theater seit Platon immer wieder gemacht wurde.
Jörn Etzold beleuchtet anschließend die Hintergründe jenes berühmten, an Hegel angelehnten Ausspruches von Karl Marx, dass sich die Weltgeschichte einmal als Tragödie und das zweite Mal als Farce ereigne. In Verschränkung mit Walter Benjamins Werk Über den Ursprung des deutschen Trauerspiels und Aristoteles' Poetik liest er Marx' Text über den Achtzehnten Brumaire des Louis Bonaparte neu, in dem Marx die bürgerlichen Revolutionen und Gegenrevolutionen seit 1789 als Theater beschreibt und zu dem Schluss kommt, eine Revolution des Proletariats müsse mit dem Theater brechen.
Den Abschluss und Höhepunkt des Bandes bildet der Beitrag von Martin Puchner, der darin ein mehrjähriges Forschungsprojekt zum Verhältnis von Philosophie und Theater in einer Klarheit umreißt, die anderen Artikeln des Bandes leider fehlt. Er betrachtet den zumeist als theaterfeindlich rezipierten Platon nicht primär als Philosophen, sondern als Dramatiker und prägt den Begriff des "dramatischen Platonismus" (S. 193). Ausgehend von den in dieser Tradition stehenden "Sokrates-Stücken" (S. 196) liest Puchner die Theatergeschichte des 20. Jahrhunderts aus einer nicht körperbezogenen Perspektive und gibt mit Georg Kaiser und Bertolt Brecht zwei Beispiele für "die Existenz eines platonischen Zuges im modernen Drama" (S. 200).
Es ist grundsätzlich begrüßenswert, dass deutschsprachige TheaterwissenschafterInnen beginnen, sich mit dem Phänomen der Theaterfeindlichkeit auseinanderzusetzen. Wie fruchtbar das Thema ist, zeigt die Vielfalt der Beiträge dieses Bandes. Schuldig bleiben die HerausgeberInnen allerdings eine Definition oder zumindest Diskussion dessen, wogegen sich Theaterfeindlichkeit richtet, was also 'theatral' bzw. was 'Theater' ist. Auch die AutorInnen beantworten diese Frage zumeist nur implizit. So schwirren den Lesenden nach der Lektüre des gesamten Bandes die Köpfe angesichts all der unausgesprochenen Konzepte und scheinbar willkürlich formulierten Oppositionspaare ('Bildkunst'-'Wortkunst'; Verschleiern-Entdecken; Spektakel-Tragödie), die den Gegensatz von 'Theater' und 'Nicht-Theater' markieren (sollen). Auch wenn die HerausgeberInnen und AutorInnen von Theatralität als einer Eigenschaft bestimmter Phänomene ausgehen, hätte die Berücksichtigung des Theatralitätskonzepts nach Rudolf Münz hier vielleicht zur Klärung beigetragen.
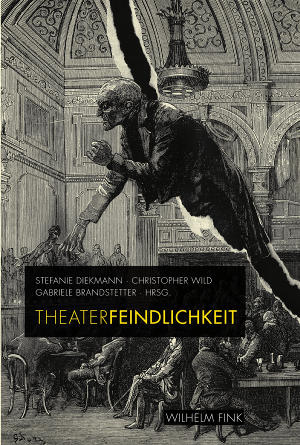
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



