Lindy Orthia (Hg.): Doctor Who & Race.
Bristol: Intellect 2013. ISBN 978-1-78320-036-8. 302 S. Preis: € 22,95.
Abstract
Bereits vor Erscheinen des Sammelbandes Doctor Who & Race wurde dem Buchprojekt große Medienaufmerksamkeit zuteil. Ohne den Inhalt der insgesamt 22 Beiträge zu kennen, begannen Boulevard- und Qualitätsmedien darüber zu diskutieren, ob die seit 1963 von der BBC produzierte Science Fiction-Serie Doctor Who rassistisch sei oder nicht.
Der Frage, die die britischen Massenmedien vereinfacht aufgeworfen und noch vereinfachter beantwortet haben, stellen sich die Autor_innen des Sammelbandes auf beinahe 300 vergleichsweise eng bedruckten Seiten. Wie ein roter Faden durchzieht die von Lindy Orthia herausgegebene Aufsatzsammlung ein Bewusstsein davon, dass eine britische Institution wie Doctor Who in einem Wechselspiel mit anderen britischen Institutionen und dem ihnen über Jahrhunderte inhärenten Rassismus steht. Kolonialismus und Dekolonialisierung werden in der Serie auf verzerrte Weise gespiegelt. Die insgesamt 23 Autor_innen sehen genau hin, benennen aufschlussreiche Brüche im Narrativ und untersuchen die Problematik vielfach deutbarer Allegorisierungen gesellschaftlicher Verhältnisse im Science Fiction- Genre.
Die Beiträge des Bandes stammen sowohl von kritischen Wissenschaftler_innen als auch von antirassistischen und feministischen Blogger_innen, die gebeten wurden, Auszüge der reichhaltigen Onlinedebatte im Buch abzubilden. Der erste Beitrag und damit quasi die Key Note stammt von der Bloggerin Fire Fly und beschäftigt sich mit dem Umstand, dass der Doctor bisher ausschließlich von weißen Männern gespielt wurde. Auch wenn er in der Logik der Serie ein Alien ist, ist er mit Whiteness aufgeladen. Sie kritisiert, dass dem Doctor der Status eines moralischen Kompasses zugeschrieben werde, "despite the fact that he's a mass murderer, often lies, steals and leaves people to suffer or die, usually without seeming to really care" (S. 19).
Die Darstellung der schwarzen 'companions', allen voran der von Freema Agyeman gespielten Martha Jones, ist problematisch, so Fire Fly. Die ihr und ihrer Familie zugeschriebene Funktion ist eine dienende. Selbst in als antikolonial lesbaren Befreiungskämpfen ist Martha zur Unterstützung des weißen männlichen Helden verdammt. Die Führungsrolle in 'Last of the Time Lords' (2007) übernimmt sie lediglich aufgrund der Abwesenheit des Selbigen.
In eine ähnliche Kerbe schlägt Iona Yeager, die sich ebenfalls mit der dritten Staffel der neuen Serie beschäftigt, also jener in der Martha Jones dem Doctor als 'companion' zur Seite steht. Sie stellt die Frage, wie das Narrativ der Zeitreise als konstituierendes Element von Doctor Who damit korrespondiert, dass die Bedrohung von schwarzen Menschen in weißen Mehrheitsgesellschaften in zahlreichen zu bereisenden Epochen massiv war. In 'The Shakespeare Code' (2007) wird eine kritische Frage Marthas, die ihre Sicherheit im elisabethanischen England betrifft, vom Doctor ins Lächerliche gezogen. Nachdem Shakespeare Martha aufgrund ihrer Hautfarbe exotisiert, werden nicht seine Äußerungen kritisiert, sondern Marthas Reaktion – nämlich als "political correctness gone mad". In der Doppelfolge 'Human Nature'/'The Family of Blood' (2007) wird Martha wiederum völlig eindimensional als Opfer von Rassismus präsentiert – sie arbeitet als Hausangestellte am Vorabend des Ersten Weltkriegs –, während die tatsächlich vorhandenen politischen Kämpfe (und Erfolge!) schwarzer Brit_innen in besagter Epoche keine Erwähnung finden.
Auch in den Belohnungs-/Bestrafungsökonomien der Serie steigen die schwarzen Figuren am schlechtesten aus, wie Linnea Dodson in einem Vergleich der 'companions' der ersten vier Staffeln der neuen Serie festhält: "In Journey's End, Rose has a reunited family and a Doctor substitute. In The End of Time (2009–2010) Donna has a winning lottery ticket. Even Sarah Jane will get a new K-9, sonic lipstick and scanner watch after School Reunion (2006). Martha does get a job recommendation, but nothing else; no help for her traumatized family, no riches, and no alien toys" (S. 33). Und Mickey – von 2005 bis 2009 regelmäßiger und genau genommen erster schwarzer 'companion' des Doctors – bekomme noch nicht einmal eine Jobempfehlung, so Dodson.
Wie sich der Thatcherismus im (Cricket-)Kostüm des fünften Doctors niederschlägt, erklärt Amit Gupta. Die Unterrepräsentation südostasiatischer Brit_innen in Doctor Who sowie in der Spin-Off Serie Torchwood thematisiert Stephanie Guerdan in ihrem Beitrag. Der Bedeutung literarischer Doctor Who-Spin-Offs für die australische Nationalidentität und ihre Krisen widmet sich Catriona Mills. Mike Hernandez verhandelt die Figur des Doctors im Spannungsfeld von privilegiertem weißem Reisenden und 'diasporic intellectual'. Davon ausgehend stellt er die Frage, welche Möglichkeiten und Probleme sich ergeben könnten, sollte sich die BBC dazu entschließen, erstmals einen schwarzen Schauspieler als Doctor zu besetzen.
Nicht nur die neue Serie, sondern auch die 'Classic Era' wird hinsichtlich ihres Umgangs mit 'race' befragt. Kate Orman kritisiert den inhärenten Rassismus in 'The Talons of Weng-Chiang' (1977) – eine Folge, die gänzlich ohne chinesische Schauspieler_innen auskommt und damit in der Tradition rassistischer Fu Manchu-Erzählungen und -Visualisierungen steht. Da Doctor Who bereits seit über fünfzig Jahren ausgestrahlt wird, lässt sich zum medialen Abbild der Transformation kolonialer in postkoloniale Verhältnisse vieles aus der Serie herauslesen. John Vohlidka befasst sich mit der allegorisierten Darstellung des Kampfes gegen westlichen Imperialismus in drei Doctor Who-Serien aus den 1970er-Jahren. Insbesondere bei 'The Mutants' (1972) handle es sich um "an outright and blatant critique of the British Empire from younger writers arguing against those who lamented the empire's fall. The story, in which the Marshal was described as 'mad', argues that anyone in favour of the empire was mad as well" (S. 135).
Das interessante Spannungsfeld zwischen tendenziell inklusiver 'Britishness' und zumeist exklusiver 'Englishness' behandelt Marcus K. Harmes anhand der Darstellung der Church of England in Doctor Who. Erica Foss zeigt die Ambivalenz der allegorisierten Fortschreibung kolonialer Verhältnisse im Zusammenhang mit der Sklavenspezies Ood auf, während Kristine Larsen sich mit Eugenik und der sich wandelnden 'racial identity' der Daleks von den 1960er-Jahren bis heute befasst. Herausgeberin Lindy Orthia kritisiert den Geschichtsdeterminismus der Serie und parallelisiert ihn mit der,in Teilen der marxistischen Linken zeitweise populären Two-stage-Theorie. Der Glaube an ein beständiges Fortschreiten der Menschheit benötige als sein Anderes die Abgrenzung von als wild und unzivilisiert dargestellten Gesellschaften sowie von ihnen zugerechneten Individuen. Orthia schließt mit der Feststellung, dass Doctor Who in einem Staat produziert werde, "built on imperialist conquest and western ascendancy, and despite good intentions, it is not always easy to excise or even identify all the threads of racism that infuse such a culture" (S. 283).
Was die Wahrnehmung des Nationalsozialismus in der britischen Nachkriegsgesellschaft betrifft, ist Doctor Who zweifellos aufschlussreich. Ähnlich wie die Serie selbst (und ihr Spin-off Torchwood) tendieren die Beiträge, die sich diesem Thema widmen aber zur Verharmlosung oder zur Perpetuierung problematischer Analogiebildungen. So setzt Alec Charles in seinem Beitrag, in dem es um die als Nebenschauplatz abgetanen Vernichtungslager in 'Torchwood: Miracle Day' geht, implizit Auschwitz mit dem Terror der Roten Khmer gleich und sein Text gipfelt in der Feststellung "from Rwanda to Kosovo to Dafur, all holocausts are unique" (S. 170), mit der er sich vermutlich gegen Kritik immunisieren will. Die Singularität der Shoah wird aufgrund der einschlägigen Wortwahl aber nur umso mehr in Frage gestellt. Eine Seite später setzt Charles die gesellschaftliche und mediale Ächtung von Pädophilen und Untoten mit jener der Figur des 'Ewigen Juden' gleich.
Eine Tendenz zur NS-Relativierung weist auch der mit 'Doctor Who and the racial state: Fighting National Socialism across time and space' betitelte Beitrag von Richard Scully auf. Während Charles lediglich die Logik von 'Torchwood: Miracle Day' affirmativ fortschreibt, anstatt sie zu kritisieren, fällt Scully sogar noch hinter die Serie selbst zurück. So interessant seine Beobachtungen zur meist indirekten Thematisierung des Nationalsozialismus und zur fallweise sehr direkten Repräsentation von Neonazis in Doctor Who sind, so irritierend sind seine historischen Einschätzungen. Zustimmend paraphrasiert er die Doctor Who-Serie 'The Curse of Fenric' (1989), deren Meta-Text darauf hinauslaufe, dass die Royal Air Force das Gleiche getan habe, wie die Nazis: "bombing innocent civilians from the air" (S. 188). Sein Bedauern ausdrückendes Resümee würden auch deutsche und österreichische Geschichtsrevisionist_innen unterschreiben: "In many ways, The Curse of Fenric and Bomber Harris were important correctives to a too-simplistic engagement with the Second World War and a fight against Nazism, but ultimately one which has struggled to find traction in a renewed culture of nationalist constructions of wartime Britain." (S. 189)
In seinem Kerngebiet, der kritischen Untersuchung von 'race' in Doctor Who, ist der Sammelband gelungen und mit vielen klugen Beobachtungen gespickt. Die auf den Nationalsozialismus bezugnehmenden Beiträge neigen jedoch – in unterschiedlichem Ausmaß – zur Relativierung. Selbst der vergleichsweise gelungene Beitrag von Kristine Larsen kommt nicht ohne eine Gleichsetzung von Adolf Hitler und Slobodan Milošević in Bezug auf ihre Gefährlichkeit aus, ohne zu reflektieren, welches Gefahrenpotential derartige Gleichsetzungslogiken – gerade wenn sie aus akademischen Kontexten kommen – in sich bergen.
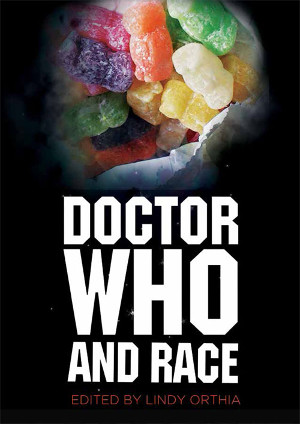
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



