Jean-Luc Nancy: Vom Schlaf (aus dem Frz. von Esther von der Osten).
Berlin: diaphanes 2013. ISBN 978-3-03734-219-0. 64 S. Preis: € 13,40 (A), € 12,90 (D), CHF 18,50 (CH).
Abstract
Welche Bedeutung wird dem Schlaf in Gesellschaften noch zugemessen, die weder den Tag noch die Nacht für ihre komplexe Arbeitsteilung benötigen? Ist der damit zerstörte Lebens- und Naturrhythmus ein Grund mehr für jegliche Art von Ungleichheit? Wird der Entzug von Tag und Nacht zu einer metaphorischen, existenziellen Folter, bei der Peiniger und Opfer dieselbe Person sind und die somit die einstigen Schlafwandler zu Besiegten macht? Jean-Luc Nancys dichtes und poetisches wie auch düsteres 'Lob' des Schlafes beabsichtigt jedoch keine Gesellschaftskritik, zumindest nicht vordergründig. Der Essay reflektiert vielmehr die Ontologie des Schlafes und verfolgt seine mythischen und philosophischen Spuren.
Es sind Operationssäle, Riesel- und Schlachtfelder, die Nancys Weltwahrnehmung bestimmen. Daher überrascht es wenig, dass die Bewohner dieser zerstückelten und finsteren Topographie schon lange auf Schlaf verzichten müssen oder, im Gegenteil, in den Schlaf künstlich versetzt werden. Diese gewaltsamen Eingriffe in den menschlichen Lebensrhythmus können nur "Besiegte […], in Lager gezwängt oder in Gräben liegend, in Lastwagen oder in Kähnen, verfolgt, von ihrer hastigen Lagerstatt aufgescheucht" (S. 51) erzeugen. Was hier nivelliert oder vielmehr beseitigt wird, ist eine Entität, ein 'Ur-Element' eines neuen Schöpfungsmythos, dessen Geschichte Nancy zu schreiben beginnt. Was ist also der Schlaf?
"Unter den tausend Söhnen des Hypnos weist Morpheus sich als derjenige aus, der gewandt die Gestalten und Züge der Sterblichen annimmt, im Unterschied zu jenen anderen, die Tiere nachahmen, Pflanzen oder andere Arten von Dingen. So kann Morpheus sein dunkles Gefieder ablegen, zum Bett der Alkyone herniedersteigen und ihr im Traum Ceyx zu erkennen geben, ihren verschwundenen Gatten. Alkyone bewegt die Arme im Schlaf und möchte Ceyx umarmen, doch sie umarmt nur Luft. Sie erwacht, läuft zum Meeresufer und erkennt auf den Fluten den Leichnam ihres teuren Vermissten. Hoch von der Klippe schwingt sie sich zu ihm hinab, denn Flügel wachsen ihr und sie fliegt" (S. 16f.).
Das Neue an Nancys Lesart des Mythos um Alkyone ist die revisionistische Reflexion ihres Fluges zum Leichnam des Ceyx. Ihr Fallen, einem Ohnmachtszustand ähnlich, ein Loslassen und ein Entsagen, wird als eine Parallele des Fallens in den Schlaf gesehen. Es ist ein Fallen gerade ohne Anspannung, vielmehr ein Flug, der sich von allem befreit und alles hinter sich lässt. Alkyone umarmt schließlich Ceyx mit ihren Flügeln, der, ebenfalls in einen Vogel verwandelt, diese Umarmung erwidert. Nach ihrer Liebesnacht schaukeln beide schlafend auf der ruhigen Meeresoberfläche. So erweist sich der vermeintliche Fall in den Tod als eine Wiedergeburt, die von einer neuen Wesenhaftigkeit geprägt ist – so auch die Schlafenden, die in sich selbst versunken sind, ohne jedoch 'Ich' oder 'Selbst' zu sein.
Ihre Existenz nimmt eine amorphe Form an. Und die Dinghaftigkeit des Schlafes ist geradezu ernüchternd, denn er ist nichts anderes als ein vegetatives 'Ur-Element', dessen Sein Atem und Stoffwechsel bestimmen. Während Nancys Körperbegriff ein fragmentarischer oder nach operativen Eingriffen ein wieder zusammengesetzter ist – in jeder Hinsicht ein variables Konstrukt –, wird der Schlaf zu einer universalen Entität. Die Absolutheit und Autonomie dieser 'Substanz' manifestiert sich u. a. in dem Verzicht auf jede äußere Ernährung: Der Schlaf ernährt sich selbst. Die neue Wesenhaftigkeit der Schlafenden kennt kein Inneres und Äußeres, sie vereint jegliche Differenzen gleichzeitig. Während die Existenz der Wachenden die Wahrnehmung von Divergenzen bestimmt, besteht für die Träumenden etwa kein Unterschied zwischen allem Seienden und dem (im Traum) Erscheinenden.
Die Schlafenden, die sich jeglicher Kontrolle, Überwachung oder der Selbstdisziplinierung entziehen, kehren gleichermaßen zu sich selbst zurück. Die Frage nach dem 'Ich' oder dem 'Selbst' gerät hier allerdings ins Abseits. Denn der Schlaf sucht nicht nach einem Bezug, einer Identifikation oder einer Präsenz. Er ist ein 'Da-Sein' kantscher Prägung, eine absolute, autonome Existenz, von jedem Zusammenhang und jeder Bindung losgelöst. Die Dinghaftigkeit des Schlafes sucht weder nach Wissen, Techniken noch Künsten, sondern lässt alles verschwinden, verdeckt und verbirgt. Denn auch das, was uns im Traum erscheint, bleibt für andere unsichtbar und damit unkenntlich. Es "zeigt sich an/in sich selbst […] in diesem winzigen und intimen Zwischenraum zwischen sich und selbst, wo selbst selbst ist" (S. 21f.). Wenn auch der Traum und damit der Schlaf von Intentionen, Absichten und Sinn erfüllt sind, lassen sie keine Analyse und Erkenntnis zu. Dies ist nicht der richtige Ort für Freuds Traumdeutung.
Mag der Schlaf unterschiedlicher Qualität sein, mal erholsam und ruhig, mal unterbrochen oder unregelmäßig, besitzt er doch für alle den gleichen Wert, denn wir alle fallen in den gleichen Schlaf. Alles Lebende teilt ihn. Er ist wahrscheinlich überhaupt der intimste Augenblick des menschlichen Lebens, in dem das Loslassen, Versinken oder einfach die Trägheit geteilt werden. Die Dualität von Tag und Nacht, also von Differenz und Gleichheit entspricht an dieser Stelle einem mythologischen Entwurf. Tag und Nacht werden zu Protagonisten einer philosophischen Schöpfungserzählung, die die jüdisch-christliche Tradition revidiert und die Nacht als das 'Andere-Sein' auftreten lässt. Die egalitäre Bedeutung des Schlafes dehnt sich gar auf Pflanzen, Flüsse und Sterne aus. Auch "Gott muss geschlafen haben […], denn sonst hätte er die Folge seines Werkes nicht auf den nächsten Tag verschoben" (S. 34). Das Göttliche des Schlafes äußert sich gerade darin, dass er Gottes Ordnung und Befehl nicht folgt.
Alkyones Fall in den Schlaf, in eine andere Wesenhaftigkeit und in eine Einheit ist zugleich ein Fall in einen zeitweiligen Tod. Schon Prudentius galt der Schlaf als Sinnbild des Todes. Die verlangsamte Atmung, der ruhige Herzrhythmus, die Präsenz der Abwesenheit machten den Schlaf für den römisch-christlichen Dichter zweifelhaft und beängstigend, als hätte er tatsächlich erkannt, dass der Schlaf eigenen und nicht göttlichen Gesetzen folgt. Die Vermischung von Wahrheit und Fiktion in den Träumen erachtete er als besondere Gefahr. Bei Nancy sind es längst das Seiende und Erscheinende, die ihn so faszinieren und die absolute Präsenz und Macht des Schlafes konstituieren. Ängste, das Entsetzen und der Horror des Schlafes, die schon Prudentius, Francisco de Goya, William Shakespeare oder Charles Baudelaire beobachteten, sind für Nancy Schlüsselerfahrungen, die das Loslassen verhindern. Schlafen bedeutet nämlich das Eintreten ins Unendliche und Ungewisse. Es ist ein Weggehen ins Nirgendwo.
Jedoch im Unterschied zum Tod verfügt der Schlaf über einen eigenen Rhythmus. Seine Regelmäßigkeit und Wiederholung bestimmt ein inneres und kein äußeres Wiegenlied. Dadurch, dass Nancy die Nacht als einen kosmischen und den Schlaf als einen biologischen Rhythmus betrachtet, gelingt es ihm, eine Ganzheit von Makro- und Mikrokosmos zu schaffen. Dem Ein- und Ausatmen der Schlafenden entsprechen die Gezeiten; das Anziehen und Abstoßen von Sternenmassen wie Geschlechtern demonstriert, welchen Anspruch er dem Schlaf verleiht. Wie Alkyone und Ceyx auf der Meeresoberfläche schaukeln, so schwingen die Schlafenden zwischen "den Dingen, den Wesen, den Substanzen oder den Subjekten, den Positionen, den Orten, den Zeiten" (S. 43).
Die Natur des Schlafes ist nicht zuletzt deswegen beängstigend, weil sie das Unsichtbare erkenntlich macht. Der ins Innere gewendete Blick der Schlafenden ist wie eine Beschauung der eigenen Leiblichkeit, einer Masse, die den Schlafenden eigen ist und doch durch ihre Durchlässigkeit sich den Schlafenden entzieht. Der nach innen gewendete Blick weist außerdem darauf hin, dass im Körper der Schlafenden eine Wachsamkeit präsent ist. Die Schlafenden sind die Wachenden. Es ist jedoch vor allem die Seele, die immer wacht und die Schlafenden vor jeglichen Angriffen des Tages schützt.
Das Unsichtbare im Schlaf ist keine Vorahnung wie im Fall Alkyones, sondern, wie Jacques Derrida in Wahrheit in der Malerei formuliert, eine Entkleidung vom Beiwerk, die Entkleidung der Entität zum bloßen Ding. Die Malerei ist insofern für Nancys Schlafkonzept von Relevanz, als er die bloße Dinghaftigkeit des Schlafes beweist, so wie sein Lehrer die Nicht-Referentialität eines Kunstgegenstandes nachwies. Derrida verglich etwa ein Stück weißes Leinen mit einem Lederstück und die aufgespannte Bildleinwand mit den genagelten Schuhen auf einem Gemälde Vincent van Goghs. So kann die Malerei ihre reine Dinghaftigkeit darstellen, die sich eben als funktionslos erweist; die Schuhe währenddessen leiten den Diskurs über die Malerei ein.
Die in kurzen Notizen und Kapiteln festgehaltenen Überlegungen Nancys eröffnen einen ganzen Kosmos, in dem der Schlaf das andere Sein darstellt. Dieser scheint die Differenzen und Dualitäten des Tages aufzuheben, indem er als das Ausgleichende und Einheitliche definiert wird: Was tagsüber noch als Differenz galt (z. B. Innen/Außen), kann im Traum in dieser Form nicht mehr definiert werden. Sowohl der Schlaf als auch die Nacht (Dunkelheit), haben die Tendenz zur Vereinheitlichung. Derridas Überlegungen zur Malerei, die dionysische und apollinische Kunstauffassung von Nietzsche, Traumfetzen Goyas und Baudelaires blitzen kurz vor diesem finsteren Horizont auf, der beindruckt und zugleich beängstigend ist. Die Vorstellung, dass der Schlaf wie ein schwarzes Loch alles aufsauge und nichts rauslasse, zieht ebenfalls über Nancys Himmel – für einen Sekundenbruchteil. Die Astrophysiker erforschen schwarze Löcher erst seit wenigen Jahrzehnten, wobei ihre direkte Beobachtung so gut wie unmöglich ist. Es ist denkbar, dass sie nur eine minimale Energie abgeben und dadurch von der Umgebung kaum unterscheidbar sind. Die ersten Skizzen von Nancy bleiben ebenfalls eher spärlich; dennoch war die Dekonstruktion noch nie dem Himmel so nah wie in diesem Band.
Trotz der dichten Sprache und der komplexen philosophischen Gedankenspiele zeichnet den Text über lange Strecken eine Leichtigkeit aus, für die sicherlich auch die Übersetzerin Esther von der Osten mitverantwortlich ist. Inhaltliche Wiederholungen ermüden gelegentlich, ihre Notwendigkeit liegt jedoch im steten Hinterfragen, Ausdifferenzieren und Neu-Entdecken des reflektierten Gegenstandes. Der dadurch entstandene poetische Rhythmus verweist auf einen weiteren persönlichen und intimen Aspekt des Essays: Die mythologischen und kosmischen Metaphern können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es der verwundbare Körper des Autors selbst ist, der den Ausgangspunkt für die Reise durch eine schlaflose Nacht markiert.
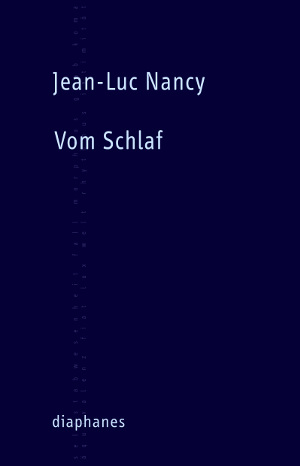
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



