Heinrich-Böll-Stiftung/nachtkritik.de/weltuebergang.net (Hg.): Netztheater. Positionen, Praxis, Produktionen.
Red. Sophie Diesselhorst/Christiane Hütter/Christian Rakow/Christian Römer. 2020. ISBN: 978-3-86928-222-0. Print/digital. 126 S., Preis: kostenlos.
DOI:
https://doi.org/10.25365/rezens-2020-2-03Abstract
Wäre die Gegenwart eine andere, hätte im Mai 2020 die achte Ausgabe der Konferenz "Theater und Netz", einer Initiative von nachtkritik.de und der Heinrich-Böll-Stiftung, stattgefunden. Stattdessen ergab sich für Theaterschaffende, Kritiker*innen und Publikum reichlich Gelegenheit, das Verhältnis von Theater und Netz in actu auszuloten: Durch die Ausgangsbeschränkungen befeuert, verlagerte sich das Theatergeschehen in die digitale Experimentierstube. Im Oktober erschien nun der Band Netztheater, der in 21 Beiträgen die Erfahrungen der vergangenen sechs Monate reflektiert – fundiert durch die Expertise der im Format "Theater und Netz" seit 2013 geleisteten Pionierarbeit. Die Kürze der zwei- bis siebenseitigen Beiträge, gepaart mit der Erfahrungsdiversität aus Herstellung, Rezeption und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, hat entscheidende Vorteile: Hier wird nicht lange umständlich unter Ausrufung irgendeines "Post-" herumgeredet oder die beliebte Formel strapaziert, Theater müsse "neu gedacht" werden. Die Beitragenden verbindet die gemeinsame Sache und so kommen sie rasch zum Punkt. Als Hybrid aus theoretischen Positionen und reflektierender Praxis bündelt die Publikation praktisch verwertbares und weiterentwickelbares Wissen kompakt und beinahe in Echtzeit. Daher verhandelt diese Rezension die Beiträge nicht chronologisch, sondern führt einander ergänzende Perspektiven zu zentralen Aspekten wie Dramaturgie, Community, Interaktion etc. kommentierend zusammen:
Der Band eröffnet mit einem Praxisbericht des geglückten Burgtheater-on-Twitter-Experiments #vorstellungsänderung, das tausende Mittweeter*innen auch abseits des Abopublikums rekrutierte. Projekte wie dieses geben Hoffnung, dass die Theater, die sich im Netz oft als singuläre kulturelle Leuchttürme gebärden, durchaus von den Praktiken der Sozialen Medien profitieren können: Like, share, comment, retweet sind schließlich nichts anderes als digitale Kürzel für gemeinschaftsstiftende Interaktionen, basierend auf Emotion, Zuspruch, Diskussion und Multiplikation. Vielleicht sind in Zukunft ja auch vermehrt offen und öffentlich geführte Dialoge zwischen Theaterhäusern zu erwarten?
Netztheater geht davon aus, dass die Suche nach digitalen künstlerischen Ausdrucksformen sich nicht erst daraus ergibt, dass Hygieneregeln und Distanzierungsvorgaben die Modi des Zuschauens kurzfristig verändert haben. Auch tradierte Annahmen über das Publikum sind zu überprüfen. In ihrem kollaborativen Text "Das Theater der Digital Natives" beobachten Irina-Simona Barca, Katja Grawinkel-Claassen und Kathrin Tiedemann, dass die Digitalisierung längst "in Form von Alltagstätigkeiten und Wahrnehmungsweisen" (S. 16) im Theater angekommen sei. Das Theater ist kein geschützter Ort, an dem die Zeit stehen geblieben ist. Vielmehr tragen die Zuschauer*innen die Welt, in der sie leben, unweigerlich in ihn hinein. Das betrifft auch Praktiken des Multitaskings bzw. des 'Second Screen', also die Gleichzeitigkeit mehrerer Interfaces und Informationsquellen. Jahrhundertelang war der zentralperspektivische Blick der Barockbühne prägend für die Organisation einer exklusiven Aufmerksamkeit im Theater. Wiewohl es also eine neue Erfahrung für die Theaterhäuser ist, "Nebenbeimedium zu sein" (S. 20), wie Judith Ackermann betont, ist es höchste Zeit, diese 'verstreute' Aufmerksamkeit im Inszenierungsprozess aktiv mitzudenken und gezielt einzusetzen. Dabei ist die Diversität des Publikums inklusive der unterschiedlich ausgeprägten Media Literacy zu beachten, denn nicht alle Zuschauer*innen werden sich augenblicklich z. B. in einer gamifizierten virtuellen Umgebung zurechtfinden: "Indem ich im digitalen Raum Zusatzinformationen – Hintergrundinfos zum Stück, zur Produktion – zu meinen Inszenierungen streue, kann ich zum Beispiel auch dem 'analogen Publikum' einen Mehrwert bieten, der es aber nicht verschreckt." (S. 22)
Für eine Dramaturgie des Digitalen ist Aristoteles allenfalls partiell ein guter Ratgeber. Zu viele Komponenten sind neben 'der Story an sich' an der Architektur der Erzählung beteiligt. Einige Elemente des 'klassischen' Storytellings lassen sich psychologisch für den digitalen Raum begründen: Das Überschreiten der 'Schwelle' etwa wird als zentraler Moment markiert, zumal die Spielregeln für das Dahinterliegende noch nicht festgelegt sind – die Verständigung auf "Floskeln, Rollen und Situationen" (S. 71) hat erst zu erfolgen. Friedrich Kirschner, Professor für digitale Medien an der Ernst Busch Berlin, schlägt vor, die zur Vermittlung von "Rollen- und Erlebnissicherheit" (ebd.) dringend nötigen Ausverhandlungsprozesse im Rahmen der jeweiligen Inszenierung ästhetisch zu gestalten. Dabei setzt er auf ein Miteinander, "das im Gegensatz zu den treibenden Kräften der Plattformhalter auf Erkenntnis gerichtet ist; das Handlungsfähigkeit vermittelt anstelle von Determinismus" (S. 73). In diesem Sinne schlägt Ackermann überdies vor, "modular" zu denken, also "leichte Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten" zu schaffen, "indem man immer wieder die Möglichkeit gibt dazuzustoßen" (S. 21).
Wiederholt wird das Serielle als Chance für neue Theaterformen ausgewiesen, beispielsweise um "durch gemeinsames, geteiltes Wissen über einen langen Zeitraum […] eine Beziehung zu Figuren auf[zu]bauen, sie mit der eigenen Lebensrealität ab[zu]gleichen und mit Freund/innen [zu] diskutieren" (S. 72), wie Kirschner in "Teilhabe als Notwendigkeit: Theater als Raum pluraler Gemeinschaften" schreibt. Um diese Gemeinschaftsbildung ist es auch Christiane Hütter zu tun: Die Community ist das Herzstück des Theaters, weshalb die künstlerische Energie aktuell vor allem darauf zu verwenden sei, "dass Leute wiederkommen, dass sich Routinen und Rituale entwickeln, dass serielle Formate entstehen" (S. 45). Diese Community aufzubauen, "das ist ein Handwerk, das eine Strategie, Zeit und Inhalte benötigt" (S. 30), weiß auch Christian Römer, Referent für Kulturpolitik und Neue Medien der Heinrich-Böll-Stiftung, in seinem Plädoyer "Für ein Theater @home!". Essentieller Bestandteil dieser Strategie, die vorerst noch strategisch auf eine Gemeinschaft "vor der Bezahlschranke" setzen müsse, sei die "Arbeit an der eigenen Identität als Theater im Netz" (ebd.). "Ein Schaufenster in die eigene Vergangenheit stärkt die Bindung des Publikums an 'sein' Theater." (S. 29) Man möchte hinzufügen, dass die "Verbindung zur [eigenen] Geschichte" (ebd.) auch nach Innen identitäts- und strukturbildend wirken und so womöglich die ein oder andere Erschütterung abfangen kann, die die Theaterschaffenden gegenwärtig persönlich und als Gemeinschaft erleben.
Wie zugkräftig Selbstmarketing bzw. 'Branding' in Sachen Follower*innenschaft ist, lässt sich beispielsweise bei erfolgreichen Influencer*innen beobachten. Der Dramatiker und Dramaturg Konstantin Küspert zeigt in "Sozialmediale Theaterräume: Die performative Parallelwelt von TikTok" überaus schlüssig auf, welche "Grundelemente theatraler Praxis" in Social-Media-Formaten zu finden sind: "TikToks müssen, um erfolgreich zu sein, praktisch immer eine Pointe haben, meistens überraschend und lustig, und damit grundsätzliche Elemente einer Narration – teilweise regelrechte Fünf-Akt-Strukturen oder Rekontextualisierungen im Miniformat – nachbauen." (S. 26) Auffällig sind auch Praktiken des Samplings, wie sie schon in Hans-Thies Lehmanns Postdramatische[m] Theater, das jüngst seinen zwanzigsten Geburtstag feierte, zu finden sind: Denn auch bei TikToks wird "reinszeniert, kontextualisiert und koproduziert" (ebd.). Aber manchmal ist es gerade das Ähnliche, das trennt. Man stelle sich etwa einen Burgschauspieler auf der Bühne eines Kölner Karnevalsvereines vor. So verlockend wasserdicht die von Küspert angestrengte Gleichung auch anmutet, lässt sich eigentlich nur in der konkreten Anwendung überprüfen, "was vom eigenen Formenrepertoire übersetzbar ist" (S. 84).
Der schmerzliche Verlust öffentlicher Orte, zu denen auch das Theater als Raum der gesellschaftlichen Verständigung gehört, zieht sich leitmotivisch durch die Texte des Sammelbandes. "Die Corona-Krise ist eine Krise der Versammlung" (S. 35), bringt Dramaturg Cornelius Puschke diesen Umstand zu Beginn seines "Plädoyer[s] für 1000 neue Theater" auf den Punkt. Dass es sehr wohl auch im Internet Formen von Gemeinschaftsbildung gibt, die sich auf dezentrale Weise organisieren, beobachtet Christiane Hütter mit kritischem Interesse: "QAnon und Konsorten glänzen mit orchestriertem Storytelling, outgesourced an viele, mit einem übergeordneten World-building-Framework, das Inkonsistenzen erlaubt" (S. 41). Eine Aufgabe des Theaters könnte es sein, positive Gegenangebote zu entwerfen, die dieser Sehnsucht nach Gemeinschaft, Austausch und gemeinsamer Erzählung entsprechen.
Wie aber können solche Dialog und Austausch befördernden Formate aussehen? Die interdisziplinäre Künstlerin und Game Designerin Christiane Hütter, aus deren Feder insgesamt drei Texte des Bandes und zwei Interviews stammen, entwirft zu diesem Zweck eine "Typologie von Interaktion, Kollaboration und Partizipation" in übersichtlich tabellarischer Form, denn häufig enttäuschten 'interaktive Stücke' durch "Pseudo-Interaktions-Möglichkeiten" oder "asymmetrische Interaktion" (S. 44). Angesichts der pandemiebedingten Einschnitte in die Möglichkeit, durch Handlungen 'stattzufinden', ist es eine der wichtigsten Herausforderungen an Inszenierungsprozesse, die Agency der Zuschauer*innen sinnvoll zu integrieren. Die Nachtkritikerin Esther Slevogt plädiert explizit dafür, die Webseiten der Theater als "Portale in den digitalen Raum" und "Interfaces" (S. 109) zu behandeln. Diese verstehen sich gegenwärtig eher als Sende- denn als Empfangskanäle; die einstigen Gästebücher sind längst in selbstverwaltete Facebook-Gruppen migriert und bilden hier den kulturkritischen Versammlungsort einer recht spezifischen Theaterklientel.
Eine Brücke zwischen analog und virtuell, Inszenierungs- und Alltagsgeschehen könnten hybride Formate herstellen. Der Theaterregisseur Christopher Rüping beschreibt Hybridität durchaus als Challenge, weil "sich die kulturellen Praktiken des einen und des anderen so beißen". Eine Inszenierung, die so divergente Rezeptionsbedingungen berücksichtigt, sei entsprechend komplex im Herstellungsprozess und müsste "auf achtzehn Ebenen gleichzeitig" funktionieren: "Interaktivität, die nur im digitalen Raum stattfindet, während ich analog zuschaue und davon ausgeschlossen bin, ist merkwürdig." (S. 94) Zudem ist es auch für Darsteller*innen eine neue Erfahrung, auf die weder Ausbildung noch bisherige Praxis sie angemessen vorbereitet haben. So stellt Ackermann die berechtigte Frage: "Wie kann den Schauspieler/innen das Gefühl vermittelt werden, dass sie keinen Film machen, sondern dass sie mit Personen interagieren, die nicht Teil der performenden Gruppe sind – auch wenn diese Personen nicht physisch kopräsent sind?" (S. 21)
'Gemeinsames Erzählen' prägt die Entstehungsgeschichte unserer Kultur, Gesellschaft und Sozialisation. Keine Entwicklung ohne Kooperation, keine Innovation ohne Vorstellungsvermögen. Netztheater könnte ein System der jahrhundertelangen Professionalisierung von Theater neu in Bewegung bringen, weil es Expertisen unterschiedlicher Provenienz bedarf und den Grundgedanken von Crowdsourcing in Schaffensprozesse integriert. Aber sind wir wirklich bereit für künstlerische Formate mit offenem Ausgang? Widerspricht das nicht dem Prinzip von Inszenierung? Müsste man das Profil der Regie – der ja gerade im deutschen Sprachraum besondere Deutungshoheit zukommt – womöglich neu definieren? Aktionen von Zuschauer*innen, die aktiv am Handlungsverlauf mitschreiben, sind schwer zu antizipieren; die Interventionen von Trollen und Bots brechen unerwartet in den Handlungsverlauf ein. Aber vielleicht ist es angesichts der Erschütterungen von 2020 gar keine dumme Idee, statt vorgefertigter Handlungsbögen flexibel adaptierbare Aktionsmodelle zu entwerfen, mit denen auf den Einbruch des Unvorhergesehen reagiert werden kann.
Frank Rieger vom Chaos Computer Club beforscht Mixed-Reality-Projekte bereits seit den 1990er-Jahren. "Hybride Räume, digitale und interaktive Formate" hätten bereits eine lange Geschichte, allerdings gäbe es immer wieder "unrealistische Annahmen über das, was die Technik am Ende leisten können wird" (S. 61). Mitunter behindere aber gerade die entgegengesetzte Annahme die Umsetzung: "Man kriegt ein staatliches Theater für eine große Produktion nur dazu, das auch im digitalen Raum zu machen, wenn die das gleiche Gefühl von ernsthafter Technik haben" (S. 94), weiß Regisseur Christopher Rüping aus eigener Erfahrung. Andere Internetformate bewiesen, dass es nicht immer schweres Gerät erfordert, denn "im digitalen Raum dieses Erlebnis [von Gemeinschaft] zu stiften" sei etwas, das "jedem mittelmäßigen Streamer gelingt" (ebd.). Die Ursache für solche Trugschlüsse sieht Rieger in der Inselexistenz, die viele Theater fristen. Der Branche fehle noch immer eine "breite Kultur des ehrlichen Erfahrungsaustausches, der Diskussion von technischen, inhaltlichen und Projektmanagement-Fehlern" (S. 62), sodass das Rad immer wieder neu erfunden werden müsse. Dem entgegenzuarbeiten beabsichtigt die im vergangenen Jahr gegründete Dortmunder Akademie für Digitalität und Theater. Gemäß ihrer Open-Source-Strategie will sie "Nerdkultur […] ins Theater reinbekommen" (S. 67) und die Erkenntnisse ihrer prototypischen Arbeit in Tutorials, Talks und Wikis zugänglich dokumentieren.
In ihrer Auswertung der Netztheaterexperimente des ersten Pandemie-Halbjahres bemerken die Bandredakteur*innen Sophie Diesselhorst und Christian Rakow, dass "das Gros […] piratischen Charakter" hatte. "Es entstammte der Freien Szene oder ging auf Initiativen von Einzel-Künstler/innen zurück, die sich ihre eigene Infrastruktur bauten und einfache technische Lösungen jenseits des Stadttheater-Apparats fanden." (S. 89) Man kann annehmen, dass dieser Innovationsgeist zumindest teilweise der Not geschuldet war. Denn selbst Projekte an etablierten Häusern sind häufig von externen Zusatzförderungen abhängig. Um über den eigenen Guckkasten hinauszudenken, haben einige Theater bereits Kontakt zu freien Künstler*innen und Kollektiven aufgenommen. "Es gibt viele kleine Aufträge von Theatern, die sagen: 'Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wollen Sie etwas ausprobieren?'" (S. 97), schreibt die britische Kritikerin Alice Saville. Diese vorsichtige Kontaktaufnahme birgt die Chance, das Gespräch darüber zu beginnen, wie sich festgefahrene Strukturen künstlerisch und wirtschaftlich öffnen lassen. Eine Möglichkeit wäre, Theater künftig als "Agenturen für das Dramatische" zu denken, wie am 13.11.2020 bei der Onlinetagung "Postpandemisches Theater" vorgeschlagen wurde, die ebenfalls auf die Initiator*innen des Sammelbandes zurückgeht.
Für die Pluralität und Interdisziplinarität der Branche steht übrigens auch, dass keine der Autor*innenbiographien einen linearen Verlauf aufweist, geschweige denn sich auf eine einzige Berufsbezeichnung zurückführen ließe. Eine der aktuellen Herausforderungen besteht darin, Jobprofile zu überdenken. In Christiane Hütters Entwurf für ein "Theater der Gegenwart" ändert sich die Organisationsstruktur auch auf der Leitungsebene: "Es geht in Zukunft vor allem auch darum, die Gesamtprozesse zu koordinieren, Projektmanagement zu machen, Herstellungsleitung für Situationen, Care-Arbeit fürs Team." (S. 45)
Ein Kernanliegen der Publikation ist das Plädoyer für eine 'vierte', digitale Sparte – wobei zu bemerken ist, dass das digitale Theater sich diesen vierten Platz vielerorts mit dem Theater für junges Publikum teilt. Dieser Befund ist symptomatisch, werden doch Digitalität und Jugend oft zusammengedacht. Berücksichtigt man die zeitliche Dimension – "in naher Zukunft wird es nur noch Digital Natives geben" (S. 16) – wird rasch klar, dass es sich um eine voreilige Schlussfolgerung handelt. Die sich andeutende Marginalisierung verheißt wenig Gutes für die so dringend nötigen Finanzierungsstrukturen und Fördermodelle, zumal auch die Verantwortung, diese 'vierte Sparte' zu gestalten, damit demselben Personenkreis zugesprochen wird. Folgerichtig wird immer wieder sachlich bemerkt, dass zum Aufbau einer künstlerischen Infrastruktur tatsächliche Ressourcen in Form von Zeit, Geld und neuen Stellenprofilen am Theater benötigt werden. Einige Häuser haben bereits erste Schritte gesetzt und beschäftigen neben Positionen wie Social Media oder – neudeutsch – Community Management nun auch Programmierer*innen. Das Staatstheater Augsburg, das sich bereits im Frühjahr "einen Namen als VR-Hochburg mit einem umfangreichen Spielplan an Virtual-Reality-Produktionen" (S. 99) machte, hat mit Beginn der Spielzeit 2020/21 Tina Lorenz als "Projektleitung für Digitale Entwicklung" eingestellt; das Schauspielhaus Zürich holte für seine Webserie Dekalog den Designer für Virtuelle Interaktion, Timo Raddatz, ins Boot.
Für eine "Digitale Sparte" argumentiert auch Elena Philipp, die die Münchner Kammerspiele, das Staatstheater Augsburg und das Hebbel am Ufer als Case Studies ins Feld führt. Die Nutzung digitaler Technologien beschränkt sich aber naturgemäß nicht nur auf die künstlerische Außenwirkung, sondern bietet auch ganz praktische Lösungen: Produktionsvorgänge – und sogar der ökologische Fußabdruck – können beispielsweise durch 'virtuelle Bauproben', 3D-Modelle und die Nutzung von Extended Reality (XR) wesentlich erleichtert werden. Mit der routinemäßigen Nutzung digitaler Technologien stehen auch neue Inhalte in Aussicht. Derzeit erfahre die Form zu große Aufmerksamkeit, zitiert Philipp Tina Lorenz, die konkrete Vorschläge für inhaltliche Schwerpunkte abseits der tausendsten Neuauflage von Goethe und Schiller macht: "Noch ist das Medium die Message, aber wir müssen Geschichten für das digitale Zeitalter entwickeln, über die Gig Economy, Smart Cities oder darüber, wie Kommunikation, Aktivismus und soziale Bewegungen im 21. Jahrhundert funktionieren." (S. 102)
Der Blick der Herausgeber*innen inkludiert auch Länder, deren staatliche Subventionsstrukturen weit weniger privilegiert beschaffen sind als im deutschsprachigen Raum. Alice Saville stellt in ihrem Beitrag "Keine Show ohne Publikum" einige Beispiele aus "Großbritanniens immersive[r] Theaterszene im Lockdown" vor, die ja aufgrund ihrer Organisationsform – weit mehr Touring Companies als feste Ensembletheater – ein gewisses Training in innovativer Raumgestaltung besitzt. Der Stadtplaner und Theaterleiter Trevor Davies berichtet von seinen Erfahrungen mit der hybriden Performancereihe "Wa(l)king Copenhagen", für die 100 Künstler*innen eingeladen wurden "ab dem 1. Mai 2020 über 100 Tage lang 100 kuratierte zwölfstündige Walks […] über stündliche Livestreams digital [zu] übertragen" (S. 54). Und die Kuratorin und Kritikerin Madly Pesti erzählt am Beispiel Estlands, bei dem sich die Einwohnerzahl und die Summe der jährlichen Theaterbesuche entsprechen, von der gelungenen Kooperation von Theaterhäusern und Rundfunk, die auf ein über Jahrzehnte gepflegtes Verhältnis zurückgeht: Da die Rechte der beteiligten Künstler*innen vom Estnischen Schauspielerverband vertreten wurden, konnte eine Sonderregelung für die Dauer des Ausnahmezustands verhandelt werden, um die künstlerischen Arbeiten im kulturellen Webportal des Nationalrundfunks kostenlos zugänglich zu machen.
Angesichts des vergleichsweise neuen Terrains muss das Theater sich fragen, was es aus den Erfahrungen anderer Branchen lernen kann. Denkt man beispielsweise an die wirtschaftlichen Nöte des Onlinejournalismus und die mühsame Etablierung von Paywalls, ist es sinnvoll, frühzeitig über Verwertungsmodelle bzw. den Preis von 'gratis' nachzudenken. Es gilt zu prüfen, inwiefern Limitation (zeitlich, kapazitär, Ticketing), Exklusivität (Sonderformate, Blicke hinter die Kulissen, Stichwort Onlyfans) oder Partizipations- und Mitgestaltungsoptionen als wertsteigernde Maßnahmen praktikabel und tragfähig sind. Im Kontext von Big Data ist zudem branchenweit zu diskutieren, wie sich Theaterhäuser zu privatisierten Plattformen, die ja den digitalen Raum dominieren, verhalten sollen. Erschwerend kommt hinzu, dass die ungeklärte Rechtesituation im deutschsprachigen Raum auf Netztheaterexperimente nachgerade innovationsfeindlich wirkt. "Man kann nicht Theater im Internet machen und dann aber straight die Copyright-Gepflogenheiten des Analogen anwenden wollen" (S. 93), spricht die Dramaturgin Katinka Deecke im Interview ein Feld mit raschem Klärungsbedarf an.
Wiewohl alle Texte von den Lehren aus spezifischen Best Practices leben – schließlich werden die neuen Ausdrucksformate von Pionieren "des Ausprobierens, Aneignens und Entdeckens" (S. 76) entwickelt – versammelt die Publikation in einem eigenen "Produktionen"-Kapitel gezielt Besprechungen einzelner Projekte. Sinnigerweise stammen diese Texte mehrheitlich von Menschen, die berufsbedingt einen größeren Überblick über die Rezeption der Szene besitzen: Kritiker*innen und Redakteur*innen. So kommt Elena Philipps Untersuchung des "Aufbau[s] von Online-Programmen an Theatern" beispielsweise zu dem Schluss, dass "begleitend zu einer Theaterästhetik" – beispielsweise "für Virtual-Reality-Umgebungen" – auch "das Publikum dafür entwickelt" (S. 101) werden müsse. Der Umgang mit neuer Technologie ist schließlich für alle Beteiligten zunächst eine Terra incognita.
Sophie Diesselhorst berichtet vom Online-Zusammenspiel der "Netztheater-Experimente aus Schauspielschulen", etwa der vielbeachteten Produktion Wir sind noch einmal davongekommen der Münchner Theaterakademie August Everding, die sich das Artifizielle des Mediums spielerisch überhöht zunutze machte und vermittels kluger Discord-Regie die Videokästchen in Bewegung setzte. Schade, dass die zitierten Experimente nicht zur Nachschau verlinkt bzw. verfügbar sind. Ein Grund hierfür könnte neben der prinzipiellen Unverfügbarkeit einmalig ausgestrahlter Livestreams sein, dass auch andere Quellen knapp einen Monat nach Erscheinen der Publikation bereits der 'Transitorik' des Internets zum Opfer gefallen sind.
"Virtuelle[n] Festivalauftritte[n]" widmet sich Esther Slevogt, allen voran dem Berliner Theatertreffen mit seinen streambegleitenden Sonderformaten, die mittels Chat und Videotelefonie erstmals Fachdiskurse, die sonst wenigen Eingeweihten vorbehalten sind, mitsamt den dazugehörigen Gesichtern im Internet teilten. Für das Festival Radar Ost entwarf das Künstlerduo CyberRäuber ein weboptimiertes 360-Grad-3D-Modell des Deutschen Theaters, innerhalb dessen in verschiedenen 'Räumen', inklusive der Unterbühne, Veranstaltungen im Videoformat eingesehen werden konnten. Rückgriffe auf analoge Formate – die Berliner Volksbühne entschied sich etwa für eine Magazinanmutung bei der Gestaltung ihres Festivals Postwest – können laut Slevogt durchaus inspirierend sein: Als "Transfererleichterung für das Denken immaterieller Räume" genüge mitunter eine simple Lageplanskizze, wie es schon 1995 die Association for Theatre in Higher Education der Universität Hawai'i bewies. Wenn es gilt "Übergangsschleusen von der analogen in die digitale Welt benutzer/innenfreundlich zu gestalten", votiert Slevogt ganz klar für "Pragmatismus" (S. 109).
Netztheater räumt mit dem weitverbreiteten Missverständnis auf, dass das Digitale allenfalls ein Substitut für 'das Echte' sei. Es ist an der Zeit, sich von falsch verstandenen Authentizitätsdiskursen und einer Überbetonung der 'leiblichen Ko-Präsenz', die die Theaterwissenschaft – die ja damit eine ganz eigene Agenda vertrat – an das Theater herangetragen hat, zu verabschieden. Netztheater will niemandem etwas wegnehmen. Es will das tradierte Theater keineswegs abschaffen, nicht den intimen Moment der Begegnung zweier Menschen ersetzen. Es sucht vielmehr nach technologisch unterstützten Erzähl- und Interaktionsformaten, in denen solche Begegnungen ebenfalls möglich sind. Das Digitale hat unser Denken bis in seine neurologischen Strukturen hinein verändert, die Art, wie wir kommunizieren und interagieren, wie wir uns organisieren, uns in der Welt verorten. Es hat sich in unser Verhältnis zu unseren Körpern eingeschrieben, unseren Zugang zu Wissen erleichtert und auf Herrschaftswissen basierende Hierarchien abgeschafft oder zumindest verschoben. Die Fülle an Information ist nahezu unnavigierbar geworden, Fake News haben unser Vertrauen in glaubwürdige Quellen erschüttert. Das Internet hat eine Vielzahl von alternativen Wahrheiten und alternativen Realitäten geschaffen. Das ist beängstigend, zumal in Zeiten einer Pandemie.
Das 18. Jahrhundert hat das Theater als Laboratorium gedacht und die Bühne als Ort, an dem Probehandeln möglich ist, um etwas über unser Menschsein zu erfahren. Auch das Netztheater ist ein solches Laboratorium, ausgestattet mit den Gerätschaften der Gegenwart, die etwa Aufschluss darüber geben können, wie unsere Wahrnehmung beschaffen ist oder wie sich Aufmerksamkeit organisieren lässt. "Theater ist die Institution mit dem ältesten Wissen über die gesellschaftliche Kraft des Spielens." (S. 15) Philosophie und Soziologie veranschlagen im Spiel die Grundlage unseres Menschseins. Es wäre fatal, die verfügbaren virtuellen Spielzeuge und technischen Gadgets jenen Player*innen zu überlassen, deren Interessen wirtschaftlich, militärisch oder politisch getrieben sind. Indem wir unser über die Jahrtausende gewachsenes Wissen über Theatralität und Inszenierungsformen einsetzen, um spielerisch zu experimentieren, erlernen wir den Umgang damit und finden heraus, welche Weltgestaltung mit ihnen möglich ist. Die Lektüre der Beiträge zeigt deutlich: Die vielfach beschworene Minimaldefinition des Theaters – A geht durch einen Raum während B zuschaut – beinhaltet keinerlei Spezifikation, dass B sich dabei im selben Zimmer befinden muss.
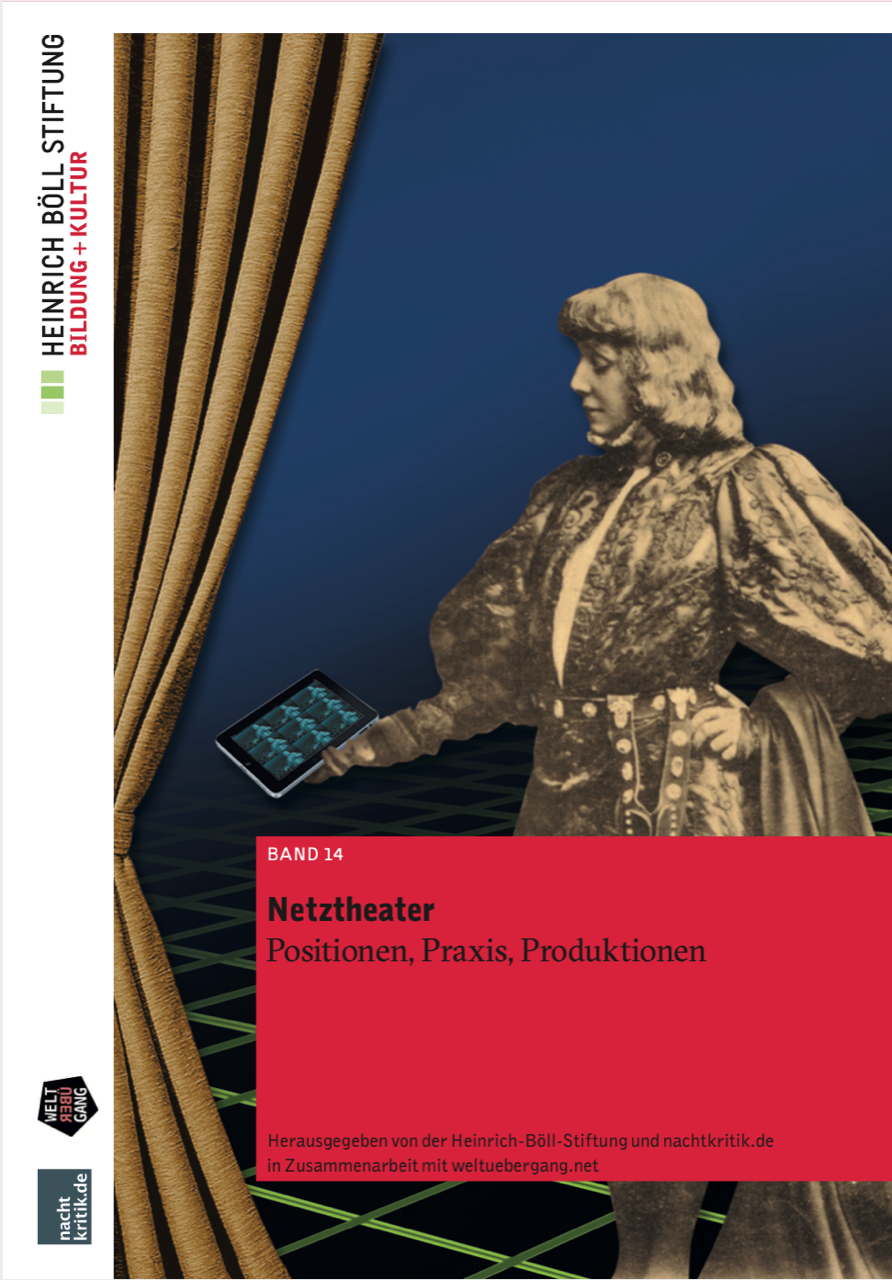
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2020 Stefanie Schmitt

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



