Marten Weise: Dialog als Denkfigur. Studien in Literatur, Theater und Theorie.
Bielefeld: transcript 2024. ISBN 978-3-8376-6951-0. 434 Seiten, 39,00 €.
DOI:
https://doi.org/10.25365/rezens-2025-1-06Abstract
Die Lektüre von Marten Weises Monografie Dialog als Denkfigur setzt ein Denken 'nach dem Fall' voraus, eine Bereitschaft, dramentheoretisch orientierte, stabile Begriffsbildungen in der Theaterwissenschaft kritisch zu hinterfragen, sogar brüchig werden zu lassen und sich jenen philosophischen Zusammenhängen zu öffnen, in denen die abendländischen Konzepte des Dialogs eigentlich wurzeln. Was diese philosophischen Zusammenhänge miteinander verbindet, ist ein Walter Benjamin’sches Denken ‚nach dem Fall‘.
In seiner Studie "Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen" (1916) geht Benjamin von der Annahme aus, dass die menschliche Sprache ausschließlich im Paradies auf intakte Weise funktioniert und eine Identität von Wort und Sache, Bezeichnendem und Bezeichnetem geschaffen habe. Nach dem Fall habe das Wort an seiner generativen Kraft verloren, sodass sich stets ein Unterschied zwischen dem Gemeinten und dem Gesagten auftue. Diese Denklogik, die den Zerfall des Phantasmas von einer unmittelbaren und unmissverständlichen Kommunikation im Moment der Austreibung des Menschen aus dem Paradies setzt, hat Nikolaus Müller-Schöll – die Regieästhetik Christoph Schlingensiefs zum Anlass nehmend (Vgl. Müller-Schöll 2006) – auf das Theater bezogen und darauf hingewiesen, dass "für Benjamin letztlich das Zeitalter der Unübersichtlichkeit, das Zeitalter der verschwundenen Einheit, die Zeit nach der allumfassenden Ordnung, nach dem idealen, alle Fragen und Konflikte grundsätzlich regelnden System im Moment des biblischen Falls beginnt" (Müller-Schöll 2006, S. 361). Unübersichtlichkeit und Antwortlosigkeit sind Phänomene, die vor dem Hintergrund von Benjamins Sprachauffassung mit der menschlichen Zivilisation gleichursprünglich sind und nur von denjenigen "als Erfahrung der Modernität bezeichnet" (Müller-Schöll 2006, S. 361) werden, die an Romantizismen der Geschichtsschreibung und der geschlossenen Repräsentation festhalten wollen.
Was Benjamins Überlegungen zum Zeitalter 'nach dem Fall' verdeutlichen, ist die immer schon von Störungen und Krisen durchwaltete Geschichte des dramatischen Theaters und somit jener Idealvorstellungen wie etwa des Dialogs – verstanden als eine egalitäre, "'spiegelbildlich' gefasste 'zwischenmenschliche Dialektik'" (S. 37), die "das menschliche Gegenüber von Gleich zu Gleich zu repräsentieren" (S. 33) vermag und die Weise zufolge problematisch geworden ist. Statt den Dialog als eine eng gefasste, auf eine Alter-Ego-Beziehung reduzierte Form der Kommunikation zu denken, in dem gesellschaftliche Konflikte vermeintlich auf den Punkt gebracht und verhandelt werden könnten, rückt Marten Weise eine 'Dialogik' in den Vordergrund seiner Analysen, eine Figuration also, die Unterbrechungen mitzureflektieren hilft und für das Denken der Anderen als Fremden sowie für nicht-menschliche Dimensionen der Repräsentation offen bleibt.
Marten Weises methodischer Zugriff auf den Dialog bzw. auf seine abendländische Konzeptualisierung ist bemerkenswert und außerordentlich anregend. Ihm geht es nämlich an keiner Stelle um ein begriffliches Denken des Dialogs, d.h. weder um seine definitorische Erschließung noch um seine theaterästhetische Festschreibung. Mit Rekurs auf Blumenberg steht immer der Dialog als Denkfigur im Fokus und damit der Anspruch, dynamische, kreative und vor allem repräsentationspolitisch äußerst progressive Denkräume zu eröffnen, und zwar dort, wo der Dialog als Diskurselement in der Geschichte des Theaters, der Philosophie und der Literatur auftaucht. Diese Denkräume sind zugegebenermaßen aufwühlend, verunsichernd, aber auch inspirierend. Sie affizieren und verkomplizieren ein theatertheoretisches Denken, das in der Tradition von Peter Szondi und Hans-Thies Lehmann auf Entwicklungs- und Krisengeschichten des Dramas fundiert ist. Szondi und Lehmann begreifen den Dialog als "Modell, Figur und Verwirklichung einer dialektischen Bewegung der Aufhebung von Gegensätzen in die Einheit des Dramas als formal-inhaltliche Subjekt-Objekt-Totalität" (S. 33), wodurch die Gefahr besteht, dass er auf eine egalitäre, von Rationalität geleitete Wechselrede zwischen Individuen reduziert bleibt.
Das vorliegende Buch setzt sich daher ein Doppeltes zum Ziel: Es führt zum einen die Unmöglichkeit des Dialogs vor Augen und zeigt, dass dieser immer schon in der Krise, ja immer schon ein Dialog 'nach dem Fall' war. Zum anderen erhebt Weise den Anspruch, den "Dialog nach dem Dialog" zu denken, ihn also "ausgehend von den Bedingungen seiner Unmöglichkeit und vor dem Hintergrund seines je spezifischen Auftauchens anders und aufs Neue [zu fassen]". (S. 397) In diesem Sinne bildet ein close reading von Levinas den Auftakt des Buches, in dem das symmetrische Konzept des Dialogs mit der Annahme konfrontiert wird, dass wir "dem Anderen lediglich in einer Verfehlung begegnen [können]". (S. 88) Vom Denken des Politischen nach der Shoah, d.h. nach einem radikalen Einschnitt in die Geschichte der Repräsentation, sind auch Hannah Arendts Überlegungen zum Dialog geprägt. Wie Weise eindrücklich zeigt, geht ihr Verständnis vom Dialog ebenfalls nicht von Konstellationen zwischenmenschlicher Kommunikation aus, sondern von einem auf Sprachlosigkeit basierendem Geschehen, einem 'differenztreuen' Denken des Seins und einer "Repräsentierbarkeit im Relationalen". (S. 154)
Die Lektüren sind komplex, doch sie setzen kein philosophisches Vorwissen voraus. Weise gelingt es, zentralen Begrifflichkeiten unseres Faches eine diskursgeschichtliche Tiefe und eine philosophische Fundierung zu verleihen. Besonders aufschlussreich ist das Hegel-Kapitel, das die herkömmliche dramentheoretische Lektüre seines Dialog-Verständnisses radikal in Frage stellt. Denn im Anschluss an Szondi und Lehmann wird Hegels Verständnis vom Dialog als ein Spiegelverhältnis zwischen dem Subjekt und einem menschlichen Anderen verstanden, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts in eine Krise gerät und als ein vereinfachtes Arrangement für die Darstellung (inter-)subjektiver Erfahrung entpuppt wird. Weises eindrückliche Hegel-Lektüre nimmt jedoch einen anderen Ausgangspunkt, und zwar Paul de Mans Hinweis auf eine rhetorische Differenz, ja auf die Spaltung zwischen Sprachgeschehen und Referenz: "Could it be that Hegel is saying something [...] that we cannot or will not hear because it upsets what we take for granted, the unassailable value of the aesthetic?“ (Paul de Man 1996, S. 95) Die Individuen, die sich im Drama aussprechen, „bringen zum Ausdruck, dass sie mit sich selbst nicht übereinstimmen" (S. 283) – schreibt Weise und macht damit deutlich, dass es dramatische Individuen nur geben kann, insofern sie in einer Disharmonie mit sich selbst stehen. Vor diesem Hintergrund erweist sich Hegels Verständnis vom Dialog wesentlich komplexer als eine Alter-Ego-Konstellation: Der Dialog ist "nicht schlichtweg Mittel für einen zwischenmenschlichen Bezug, sondern die Ausstellung der vielfältigen Möglichkeiten des Bezugs im Drama" und damit ein "Dreh- und Angelpunkt von Konflikten zwischen Figuren und von Figuren mit sich selbst", ja eine "Verhandlung der Nicht-Identität zwischen Allgemeinem und Besonderem, Meinen und Gemeintem, Ausdruck und Gehalt". (S. 284, S. 292)
Dass die Hochphase des dramatischen Theaters und des Glaubens an einer Geschlossenheit der Repräsentation eigentlich bereits eine Epoche nach dem Fall ist, bringt u.a. auch Marten Weises erhellende Lessing-Lektüre auf den Punkt. Unter anderem mit Bezug auf die Textdramaturgie von Miß Sara Sampson werden Reibungen zwischen Lessings 'dramatischen Dialogen' und dem von ihm entworfenen Dialogideal deutlich, vor allem dann, wenn innerdiegetische Äußerungen in den Blick genommen werden, die von dem*der Dialogpartner*in nicht gehört werden dürfen. Weise deckt eine regelrechte Praxis des 'Beiseitespreches' bei Lessing auf, mittels dessen "eine dramatische Figur […] zu sich selbst [spricht], […] jedoch auch eine Ansprache gegenüber dem (lesenden) Publikum [formuliert]." (S. 339)
Ein wiederkehrendes Motiv des Buches ist die produktive Abrechnung mit den weit verbreiteten, aber allzu einfachen Projektionen einer Theatergeschichtsschreibung, die in Abfolgen des Prädramatischen, Dramatischen und Postdramatischen denkt. Dialog als Denkfigur ist eine Monografie, die das Denken des Dialogs nach dem Dialog nicht nur in brillanten Lektüren verhandelt, sondern dieses Denken gleichzeitig auch praktiziert, und zwar in Form eines komparatistischen Miteinander-Lesens, des rhizomatischen Kartographierens von Korespondenzen und Fluchtlinien zwischen Autoren wie Martin Buber, Theodor W. Adrono, Martin Heidegger, Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe, Platon und Heiner Müller – und damit zwischen Denktraditionen, zwischen denen ‚Dialoge‘ bisher nicht immer vorstellbar und zu erwarten waren.
Literatur:
Nikolaus Müller-Schöll: "Wie denkt Theater? Zur Politik der Darstellung nach dem Fall", in: ders./Joachim Gerstmeier (Hg.): Politik der Vorstellung. Theater und Theorie, Berlin: Theater der Zeit 2006, S. 357–371.
Paul de Man: "Sign and Symbol in Hegel’s Aesthetics", in: ders.: Aesthetic Ideology, hg. v. Andrzej Warminski, Minneapolis: University of Minnesota Press 1996, S. 91–104, hier S. 95.
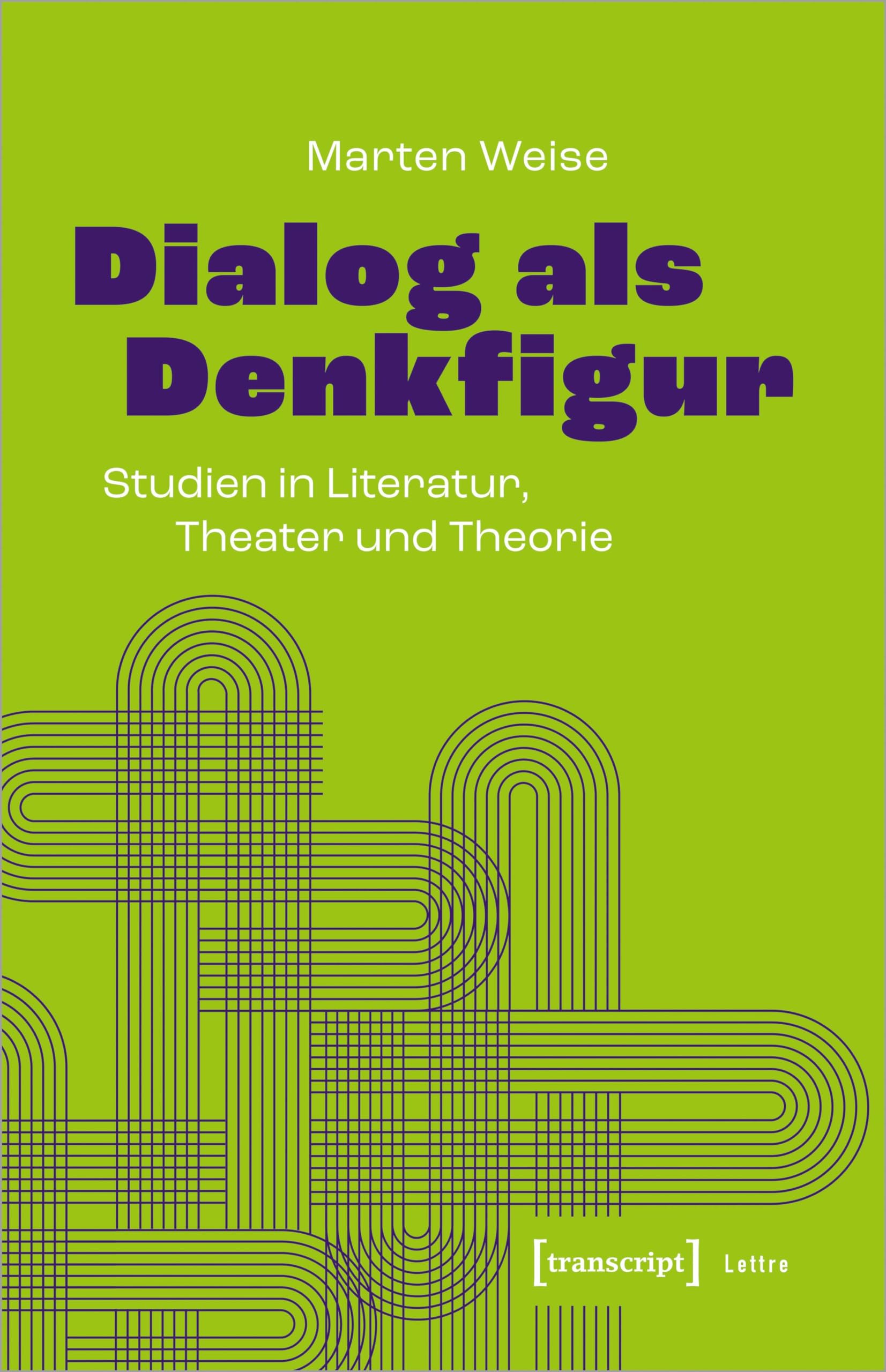
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2025 Adam Czirak

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International.
Dieser Rezensiontext ist verfügbar unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0. Diese Lizenz gilt nicht für eingebundene Mediendaten.
![[rezens.tfm] Logo](https://rezenstfm.univie.ac.at/public/journals/7/pageHeaderLogoImage_de_DE.png)



